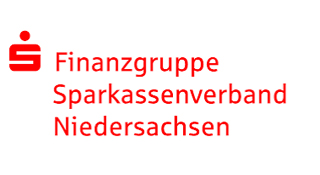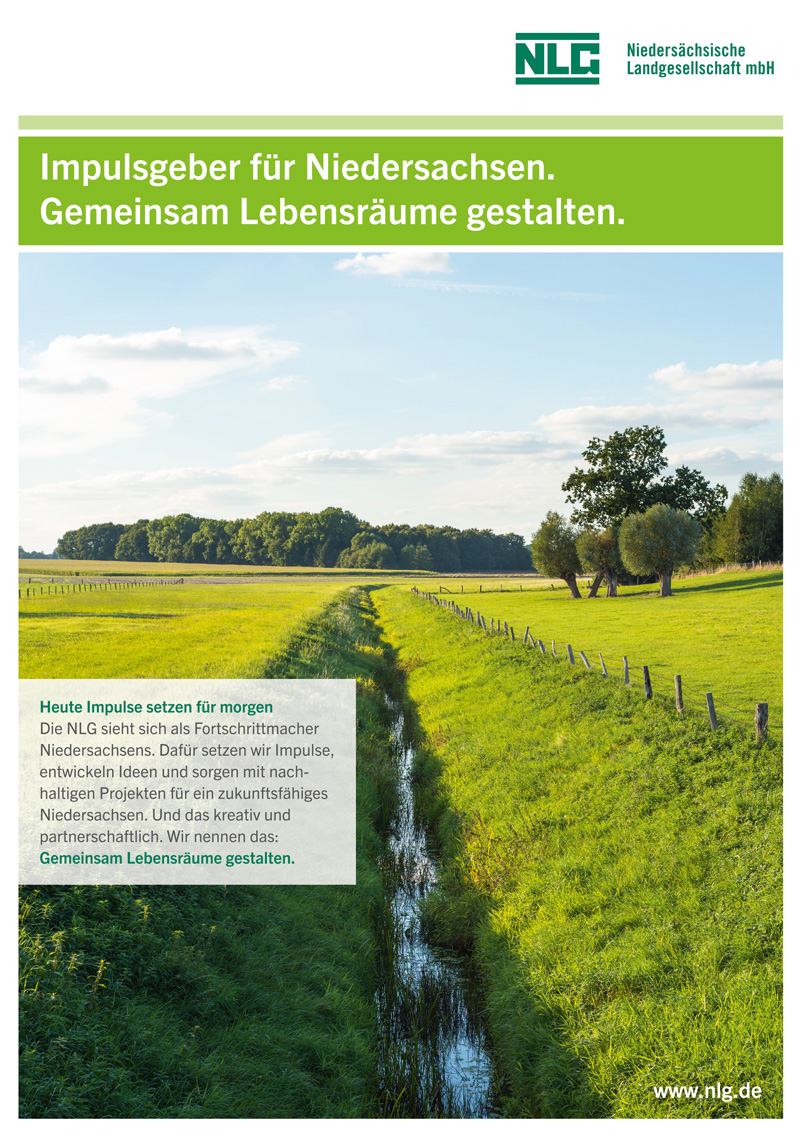Agrar- und Umweltpolitik
Verbände kämpfen gemeinsam für die Zukunft der heimischen Landwirtschaft
Die Industrieemissionsrichtlinie, die Verordnung zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur (kurz als IED, SUR, NRL oder auch „EU-Trilogie des Schreckens“ bezeichnet) – diese Themen und viele mehr standen beim Landvolk Niedersachsen im zurück liegenden Jahr auf der Agenda. Was sich bei allen Fragen und Herausforderungen wie ein roter Faden durch die Verbandsarbeit gezogen hat, ist eine verstärkte und lösungsorientierte Art der Zusammenarbeit zahlreicher Akteurinnen und Akteure aus dem ländlichen Raum.

Helmut Brachtendorf
„Das Landvolk Niedersachsen hat immer wieder betont, dass die Tierhaltung gestärkt und zukunftsfest umgebaut werden muss. Der Berufsstand kann nicht zulassen, dass immer mehr Lebensmittel importiert werden, die unter deutlich niedrigeren Tierhaltungs- und Umweltstandards erzeugt werden.“
„Die Menschen in den Moorgebieten wollen Antworten
und Lösungen von der Politik. Dafür werden wir uns
auch im nächsten Jahr wieder einsetzen.“
Herausragendes Beispiel ist dafür die Brüssel-Reise im Mai, als ein Verbändebündnis nach einer einjährigen Gegenkampagne direkt vor Ort und mit hochkarätigen Gästen seine Kritik an der Agrar- und Umweltpolitik der EU vorgebracht hat. Unter Federführung des Landvolks Niedersachsen sind Vertreterinnen und Vertreter von Landjugend, Landfrauen, landwirtschaftlichen Dienstleistern sowie Anbau- und Grundeigentümerverbänden vor Ort aktiv geworden. Das Bündnis hat am Beispiel des Niedersächsischen Weges gezeigt, was mit freiwilliger Kooperation und angemessener finanzieller Unterstützung erreicht werden kann. Auch ohne Zwangsmaßnahmen der EU können intelligente Lösungen für weniger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gefunden oder die Effizienz der Düngung gesteigert werden.
Auch wenn es seit dem Besuch in Brüssel neue Signale gibt, die rigiden Pläne zu überarbeiten, und der Weggang von EU-Kommissar Frans Timmermanns Anlass zu Hoffnung gibt, so rufen die Pläne der EU doch immer noch Existenzängste bei einem Großteil der Milchviehhalter hervor, die in den von Moor geprägten Grünlandregionen ihre Wiesen und Weiden für eine Renaturierung durch Wiedervernässung abgeben sollen.
Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, hat bei besagtem Treffen in Brüssel versprochen, dem Schutz von Klima und Artenvielfalt gerecht zu werden, und gleichzeitig eine ertragreiche Landwirtschaft ermöglichen zu wollen. Die Veranstaltung mit Diskussionspartnern aus Europaparlament, Bundes- und Landeslandwirtschaftsministerien, Wissenschaft sowie Agrar- und Umweltorganisationen zu den Sorgen und Lösungsansätzen der Landwirtinnen und Landwirte hat Gehör gefunden. Dies wirkt sich auch auf die alltägliche Arbeit im Landesbauernverband aus. Das Landvolk Niedersachsen wird wahrgenommen als wichtiger Rat- und Ideengeber, und das auf allen politischen Ebenen.
Ende der Borchert-Kommission
Nicht überraschend kam das „Aus“ der Borchert-Kommission. Cem Özdemir hatte zuvor drei Monate Zeit, sich eine Antwort auf das drohende Ende zu überlegen. Ende August legte dann das nach dem einstigen Landwirtschaftsminister Jochen Borchert benannte und von ihm geführte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung seine Arbeit nieder. Im Frühjahr hatte es bereits aus Protest pausiert und Anfang Juni seine Arbeit wieder aufgenommen. Aber das mit einer Ansage: sollte es bei der unzulänglichen Finanzausstattung bleiben, ist Schluss mit der Arbeit.
Özdemirs Reaktion auf das Ende der Kommission hat gezeigt, dass die politischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung der Empfehlungen weder in der vorherigen Legislaturperiode noch in den ersten zwei Jahren der laufenden „Ampel“ ausreichend geschaffen worden sind. Das Landvolk Niedersachsen hat immer wieder betont, dass die Tierhaltung gestärkt und zukunftsfest umgebaut werden muss. Der Berufsstand kann nicht zulassen, dass immer mehr Fleisch importiert wird. Bis Februar 2024 müssen heimische Ferkelproduzenten ihren Veterinärbehörden verbindlich anzeigen, wie sie das Deckzentrum umbauen. Das verlangt die Tierschutznutztierhaltungsverordnung. Es wird den meisten Landwirten aber schwerfallen, dies losgelöst von den noch unbestimmten, künftigen Tierwohlvorgaben anzugehen.
Klimagesetz bedroht bäuerliche Landwirtschaft
Wir müssen uns alle weiter gemeinsam anstrengen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern und den Klimaschutz zu stärken. Die Ideen aus der Politik wie den Entwurf über ein „Niedersächsisches Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes“ müssen wir jedoch hinterfragen. Der Gesetzesentwurf wird den besonderen Bedürfnissen der Landwirtschaft noch nicht gerecht. Das haben wir bei einer mehrstündigen Anhörung im Landtag deutlich gemacht. Wenn das Gesetz so umgesetzt werden würde, wäre es das Aus für große Teile der Landwirtschaft in Niedersachsen.
Die Klimaziele der Landesregierung sind so nicht auf die Landwirtschaft übertragbar, weil bei der landwirtschaftlichen Erzeugung unvermeidbar Treibhausgase anfallen. Gleichzeitig wird aber auch CO2 in Nahrungsmitteln und in Grundstoffen für die Industrie eingelagert oder Bioenergie für den Energie- und Verkehrssektor bereitgestellt. Es bedarf noch größerer Anstrengungen bis hin zu Vorrangregelungen, um landwirtschaftliche Flächen zu schützen. Photovoltaik-Anlagen sollten daher vorrangig auf bebaute oder versiegelte Flächen und danach erst auf Grenzertragsstandorte gelenkt werden. Hier brauchen wir eine aktive Unterstützung der Behörden und planenden Kommunen. Eine gesamträumliche Energieplanung ist erforderlich verbunden mit einer Standortanalyse auf kommunaler Ebene, um Fehler bei der Flächenauswahl und Unwirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs zu vermeiden.
Dass der Gesetzentwurf keinerlei Folgenabschätzung für die Auswirkungen auf die Wirtschaft beinhaltet, ist sehr bedenklich. Bei einer Umfrage unter den bedeutenden Unternehmen der niedersächsischen Ernährungswirtschaft, die das Landvolk Niedersachsen anlässlich der fehlenden breiten Verbandsbeteiligung zum Gesetzentwurf veranlasst hat, wurde ihm durch alle antwortenden Firmen mitgeteilt, dass in der gesamten Branche die kontinuierliche Reduzierung von Treibhausgasemissionen mit hoher Intensität verfolgt wird.
GAK-Mittelkürzungen gefährden ländliche Gebiete
Entgegen der eigenen Absichtsbekundung im Koalitionsvertrag der „Ampel“ sollen die Mittel in der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) drastisch gekürzt werden. Um rund ein Viertel soll der Bundesetat in diesem Bereich zusammengestrichen werden und die Sonderrahmenpläne „Förderung der ländlichen Entwicklung“ und „Ökolandbau und biologische Vielfalt“ 2024 wegfallen, damit die Schuldenbremse eingehalten wird. Damit stehen allein vom Bund etwa 300 Millionen Euro weniger zur Verfügung.
Den Landwirten sowie den Städten und Gemeinden im ländlichen Raum droht sogar noch deutlich mehr Geld verloren zu gehen: Durch die zusätzlich wegfallenden Kofinanzierungsmittel der Länder könnte der ländliche Raum bis zu 500 Millionen Euro verlieren. Dagegen hat sich das Landvolk Niedersachsen deutlich zur Wehr gesetzt, denn der ländliche Raum hat zum Beispiel mit dem demografischen Wandel, der Digitalisierung und der Energiewende eine lange Liste an Herausforderungen zu stemmen. Nötig sind lebendige, lebenswerte und wettbewerbsfähige ländliche Räume für eine starke Landwirtschaft und deshalb verlässliche Förderprogramme, um diese zu entwickeln, sowie die dafür notwendige Planungssicherheit bei der Finanzierung. Der ländliche Raum prägt Niedersachsen vom Emsland bis nach Lüchow und von Leer bis an den Harz.
Deshalb war und ist die Verbundenheit der Akteurinnen und Akteure im ländlichen Raum so wichtig. Das Landvolk Niedersachsen wird sich mit der Unterstützung der Mitglieder weiter dafür einsetzen, dass die Bündnisse funktionieren und auf allen Ebenen weiter gehört werden.


Die Delegierten haben Niedersachsens Interessen beim Bauerntag in Münster vertreten.
Die Delegationsreise nach Brüssel war der Höhepunkt der verbandlichen Arbeit im vergangenen Jahr.

Artikel von
Sonja Markgraf
Pressesprecherin
Europäische Umweltpolitik I: Landvolk organisiert Verbändeinitiative zu Pflanzenschutzverboten der EU-Kommission
Ende Juni 2022 legte die EU-Kommission einen lange angekündigten, aber wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine zunächst verschobenen Entwurf über eine „Verordnung zur nachhaltigen Verwendung vor Pflanzenschutzmitteln“ vor. Das höchstgefährliche Ziel, die Mitgliedstaaten zur Reduzierung des chemischen Pflanzenschutzes um mindestens 50 Prozent bis 2030 zu zwingen, hat unter dem Kürzel „SUR“ insbesondere in Deutschland Entsetzen ausgelöst.

Hartmut Schlepps
„Politisch erzwungene Ertrags- und Qualitätsverluste führen zum Verlust bäuerlicher Existenzen und zur Notwendigkeit, auf dem Weltmarkt einzukaufen – zu unkontrollierbaren Standards sowie mit unkalkulierbaren Risiken und Preisentwicklungen für die europäischen Verbraucher.“
Schon die erste Analyse im Landvolkhaus in Hannover zeigte, dass vor allem die vorgeschlagene Gebietskulisse für ein pauschales absolutes Verbot jeglicher Anwendungen von chemischen Pflanzenschutzmitteln in ein Fiasko münden würde – unabhängig von konkreten Risiken für Niedersachsen, Deutschland und einigen anderen Mitgliedstaaten. Später stellte sich zwar heraus, dass die Entwurfsverfasser der Kommission sich keinerlei Überblick über die flächenmäßige Auswirkung dieser Kulisse verschafft hatten, der Entwurf war damit aber erst einmal in der Welt. „Gewürzt“ wurden die geplanten Regularien durch zusätzliche überbordende bürokratische Dokumentationsanforderungen für die Landwirte.
Eingaben tausender deutscher Bauern beeindruckten EU-Kommission
Schon zu einer nachfolgenden „Öffentlichkeitsbeteiligung“ der Kommission im Internet gelang es dem Deutschen Bauernverband und dem Landvolk Niedersachsen, tausende deutscher Bauern zu Eingaben zu bewegen und die Kommission damit sichtbar zu beeindrucken. Nachdem auch die anderen Mitgliedstaaten die kenntnislosen Bürokraten in Brüssel darauf hingewiesen hatten, dass man keinesfalls bereit sei, ein pauschales Anwendungsverbot auf teilweise 80 Prozent und mehr der landwirtschaftlichen Nutzfläche in einigen Regionen Europas hinzunehmen, lenkte die Kommission ein wenig ein. In einem so genannten „Non-Paper“ eröffnete man dem Ministerrat, dass man von sich aus Vorschläge zur deutlichen Verkleinerung der Verbotsgebiete unterbreite und bestimmte Formulierungen im Entwurf gar nicht beabsichtigt seien.
Das Parlament zeigte sich darauf einerseits über die Hinterzimmerpolitik der Kommission empört, andererseits setzte man als Berichterstatterin des federführenden Umweltausschuss mit der Europa-Abgeordneten Sarah Wiener (MdEP) von den Grünen eine Fundamentalistin in der Thematik ein, was sich später in einem Stellungnahmeentwurf für den Umweltausschuss auch deutlich zeigte.
„Niedersächsischer Weg“ gibt Rückenwind in der Argumentation
Für das Landvolk Niedersachsen war schnell klar, dass Einflussnahme auf höchster politischer Ebene direkt in Brüssel notwendig sein würde, um die Folgen des Entwurfs für die Landwirtschaft und viele weitere Betroffene im ländlichen Raum deutlich zu machen. Rückenwind in der Argumentation gaben dem Verband die gemeinsam mit der Landesregierung vereinbarten Ziele zur Minderung des chemischen Pflanzenschutzes und Förderung der Biodiversität im „Niedersächsischen Weg“. Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover, dem Landfrauenverband Weser-Ems, der Landesgemeinschaft der Niedersächsischen Landjugend, dem Landesverband der Maschinenringe, der Landesgruppe Niedersachsen der Lohnunternehmer, der Arbeitsgemeinschaft der Beratungsringe Weser-Ems und der Arbeitsgemeinschaft Landberatung Hannover, der Familienbetriebe Land und Forst Niedersachsen, dem Dachverband Norddeutscher Zuckerrübenanbauer, dem Niedersächsischen Waldbesitzerverband, dem Niedersächsischen Zentralverband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden und Land schafft Verbindung Niedersachsen (LsV) wurde ein Protestschreiben direkt an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verfasst, auf dass prompt die Einladung zu einem Gespräch mit der federführenden Generaldirektion „Gesundheit und Lebensmittelsicherheit“ folgte.
Anlässlich dieses Gesprächs, das am 31. Mai 2023 in Brüssel mit der zuständigen stellvertretenden Direktorin der Generaldirektion, Claire Bury, stattfand, organisierte das Landvolk Niedersachsen einen parlamentarischen Abend. Begleitet durch die mitzeichnenden Verbände fand dieser am Vorabend des Gesprächs mit Unterstützung der Landesregierung in den Räumen der niedersächsischen Landesvertretung in Brüssel statt. Dieser Abend stieß auf sehr großes Interesse und wurde durch die Teilnahme und eine Ansprache von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und entsprechende Beteiligung aus den Reihen des EU-Parlaments sowie weiterer politischer Kreise besonders hervorgehoben. Für das Landvolk Niedersachsen und seine Partnerverbände aus dem ländlichen Raum war der parlamentarische Abend ein herausragender Verbandserfolg bei der zielgerichteten Platzierung seiner zentralen Botschaften nicht nur zur SUR, sondern auch zum Beispiel zur Naturwiederherstellungs-Verordnung.
Zu Herbstbeginn 2023 kann leider noch nicht sicher beurteilt werden, ob die SUR vor der nahenden Europawahl im Juni 2024 zwischen Parlament, Ministerrat und Kommission geeint werden wird. Nach den aktuellen Zeitplänen wird das Parlament erst in den letzten Sitzungswochen in 2023 eine Stellungnahme verabschieden, auch die Positionierung des Ministerrats steht noch aus. Die Mitgliedstaaten hatten mehrheitlich – ohne Unterstützung Deutschlands! – die Kommission zu einer konkreteren Folgenabschätzung aufgefordert, die diese mehr schlecht als recht im Juli 2023 vorlegte. Der Erkenntnisgewinn war gering, die Kommission ging kaum auf die Frage nach den Auswirkungen auf Versorgungssicherheit und Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise ein, ein besonders zentrales Thema für viele Mitgliedsländer.
Reduktion von 25 Prozent bis 2030 ambitioniert, aber machbar
Einigkeit im Berufstand und unter undogmatischen Fachpolitikern besteht darin, dass der chemische Pflanzenschutz so umweltverträglich wie möglich und nur im absolut notwendigen Umfang genutzt werden sollte. Das Landvolk sieht die Vereinbarungen zum Niedersächsischen Weg, die eine mengenmäßige Reduktion von 25 Prozent bis 2030 vorsehen, als ambitioniert, aber machbar an. Wichtig ist dem Landesverband dabei der Verzicht auf pauschale Verbote. Er will stattdessen die Förderung von Innovationen, Züchtung und modernster Ausbringungstechnik in den Vordergrund stellen. Für die populistische Gegnerschaft des chemischen Pflanzenschutzes ist dieses Bestreben naturgemäß zu wenig.
Der Berufsstand wird sich daher auch in den kommenden Jahren permanent für eine verantwortungsbewusste Politik einsetzen müssen. Diese zeichnet sich durch die Gewährleistung einer sicheren, umweltschonenden und für alle Einkommensschichten bezahlbaren europäischen Lebensmittelerzeugung aus. Politisch erzwungene Ertrags- und Qualitätsverluste führen zum Verlust bäuerlicher Existenzen und zur Notwendigkeit, auf dem Weltmarkt einzukaufen – zu unkontrollierbaren Standards sowie mit unkalkulierbaren Risiken und Preisentwicklungen für die europäischen Verbraucher.



Artikel von
Hartmut Schlepps
stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Umweltreferent
Europäische Umweltpolitik II: Umsetzungspläne zur Verbesserung der Biodiversität hoch umstritten
Mit dem „Green Deal“ hat die EU ihren dritten Anlauf seit 2000 genommen, den Verlust an natürlicher Artenvielfalt in Europa zu stoppen und eine gegensätzliche Entwicklung zu erreichen. Im Sommer 2022 legte die Kommission mit dem so genannten „Nature Restoration Law“ (NRL) dazu einen Verordnungsentwurf vor, wie dieses Ziel in den nächsten Jahrzehnten erreicht werden soll.

Hartmut Schlepps
„Zentraler Kritikpunkt der Land- und Forstwirtschaft beim „Nature Restoration Law“-Entwurf ist der erneute Versuch, weitere Schutzgebiete mit einem Schutzstatus in Europa auszuweisen, der eine wirtschaftliche Nutzung der betroffenen Flächen ausschließt und dem Naturschutz absoluten Vorrang einräumt.“
Für das Landvolk Niedersachsen war dieser Entwurf Anlass genug, um schon im Herbst 2022 im Rahmen von Gesprächen mit EU-Parlamentariern direkt in Brüssel die Bedenken des Berufsstandes vorzustellen. Höhepunkt der Verbandsaktivität war dann der „Parlamentarische Abend“ des Verbändebündnisses aus dem ländlichen Raum Niedersachsens Ende Mai 2023 in der niedersächsischen Landesvertretung in Brüssel, bei dem der Verband nicht nur auf die völlig überzogenen Reduktionspläne beim chemischen Pflanzenschutz sondern auch auf die Naturwiederherstellungs-Verordnung einging.
Umwidmung landwirtschaftlicher Nutzflächen in Naturschutzflächen
Zentraler Kritikpunkt der Land- und Forstwirtschaft beim NRL-Entwurf ist der erneute Versuch, weitere Schutzgebiete mit einem Schutzstatus in Europa auszuweisen, der eine wirtschaftliche Nutzung der betroffenen Flächen ausschließt und dem Naturschutz absoluten Vorrang einräumt. Große Sorge besteht auch bei der Forderung nach Maßnahmen zum Schutz von Insekten als „Bestäuberpopulation“, bei denen die Kommission völlig im Unklaren lässt, was darunter verstanden werden soll. Unmissverständlich ist sie aber darin, dass in Gebieten zum Schutz der „Bestäuberpopulation“ der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln von der EU vollständig verboten werden wird.
Weiterhin fordert der Entwurf, dass in einem Umfang von mindestens zehn Prozent der Fläche so genannte artenreiche Landschaftselemente beziehungsweise Flächen mit hoher biologischer Vielfalt in der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft bereitgestellt werden und bis zu 70 Prozent der heute entwässerten Moorböden wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt und wiedervernässt werden. In einem gewissen Umfang soll eine extensive Nutzung möglich sein, grundsätzlich handelt es sich aber auch dort um eine Umwidmung landwirtschaftlicher Nutzflächen in Naturschutzflächen. Außerdem sind konkrete Verpflichtungen zur Steigerung der Population an Feldvogelarten und Wiesenschmetterlingen vorgesehen sowie Anforderungen an den Bodenkohlenstoffgehalt von Ackerflächen. Diese fünf Maßnahmen fasst die Kommission unter dem Ziel der Wiederherstellung „landwirtschaftlicher Ökosysteme“ zusammen.
Die Kommissionspläne waren für das konservative Lager im EU-Parlament, das auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt, so weitgehend, dass die Europäische Volkspartei (EVP) im Frühjahr 2023 beschloss, den Vorschlag in Gänze abzulehnen. Auch einige liberale Abgeordnete unterstützten diese Richtung, die vom Deutschen Bauernverband und Landvolk Niedersachsen begrüßt wurde. Weder im Agrarausschuss noch im Umweltausschuss des Parlaments gab es daher eine Mehrheit für den Vorschlag oder maßgebliche Veränderungen.
Verpflichtungen abgeschwächt und auf Natura 2000-Gebiete beschränkt
Nach einer weitgehend populistisch geführten Debatte entschied das Parlament im Juli 2023 aber doch, das NRL zu befürworten, wenn auch unter sehr weitgehenden Maßgaben. Die Vorgaben für die „landwirtschaftlichen Ökosysteme“ (Vorgaben für Feldvögel, Wiesenschmetterlinge, Moorwiedervernässung, Landschaftselemente und Humussteigerung) sollen nach dem Willen des Parlaments entfallen. Mit ganz knapper Mehrheit wurde zudem entschieden, dass die Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten zur Wiederherstellung natürlicher Lebensräume abgeschwächt und vor allem auf die Natura 2000-Gebiete beschränkt werden sollen.
Es ist angesichts der „wackeligen“ Parlamentspositionen noch nicht sicher, ob im Herbst 2023 eine Einigung mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission in diesem Sinne erzielt wird. Eine deutliche Abschwächung des Kommissionsentwurfs zeichnet sich zwar ab, wie groß am Ende die Belastungen für die Land- Forstwirtschaft im Rahmen einer Einigung ausfallen werden, liegt momentan im Dunkeln. Für den Berufsstand waren die Anstrengungen zur Verhinderung des Entwurfs trotzdem ein Erfolg, denn so konnte erneut die Frage kritisch thematisiert werden, wieviel Verlust an produktiver Nutzfläche sich Europa leisten kann, ohne damit seine Verantwortung für die Lebensmittelversorgung und die immer größere Bedeutung dieser Fläche auch für die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und im Klimaschutz zu vernachlässigen.



Artikel von
Hartmut Schlepps
stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Umweltreferent
Europäische Umweltpolitik III: BImSch-Verfahren zukünftig für jeden Stall?
Auch um die bereits lange geltenden Genehmigungsvorschriften bei Stallbauten und Anforderungen an die Vermeidung von Emissionen aus der Tierhaltung macht der „Green Deal“ der EU-Politik keinen Bogen. In vielen Gesprächen mit EU-Abgeordneten, Bundes- und Landespolitikern verdeutlichte das Landvolk Niedersachsen seine Bedenken gegenüber den im Frühjahr 2022 veröffentlichten Vorschlägen der EU-Kommission zur Änderung der so genannten „Industrie-Emissionsrichtlinie“ (IED-Richtlinie).

Hartmut Schlepps
„Die Tierhaltung darf nicht mit großen Industrieanlagen über einen Kamm geschoren werden.“
In diesem Entwurf fordert die Kommission, die besonders aufwändigen, bürokratischen Genehmigungs- und Überwachungspflichten mit Öffentlichkeitsbeteiligung nach der IED-Richtlinie zukünftig pauschal auf Anlagen ab 150 EU-Großvieheinheiten („livestock units“) für Rinder, Schweine und Geflügel je Standort und Betreiber abzusenken. Bisher mussten die EU-Mitgliedstaaten die Vorgaben der Richtlinie, die von Anforderungen an Abfallbehandlungsanlagen und größere Industrieanlagen mit hohen Risiken von gesundheitsgefährdenden Umweltverschmutzungen geprägt ist, bei Anlagen mit mehr 40.000 Geflügelplätzen, mehr als 2.000 Mastschweinen oder mehr als 750 Sauen anwenden. Rinderställe konnten auf Initiative der europäischen Bauernverbände bei der letzten Anpassung vor mehr als zehn Jahren noch aus dem Anwendungsbereich herausgehalten werden.
Die Tierhalter müssen die „besten verfügbaren Techniken“ einsetzen
Bei Errichtung eines Stalles und nach dessen Inbetriebnahme sind bisher regelmäßige veröffentlichungspflichtige behördliche Umweltinspektionen und die Einhaltung strenger Schadstoffgrenzwerte und standortunabhängiger vorsorgender Maßnahmen zur Reinhaltung von Luft, Boden und Gewässern vorgeschrieben. Die Tierhalter müssen die für die Branche durch europäische Kommissionen erarbeiteten „besten verfügbaren Techniken“ zum Umweltschutz einsetzen. In der deutschen Umsetzung wurde über die so genannte TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) dazu beispielsweise jüngst die Installation von Abluftwäschern zur Filterung von Staub, Ammoniak und Geruch vorgeschrieben. Außerdem setzt Deutschland die Richtlinie in etwas abgemilderter Form bereits für Anlagen ab 15.000 Legehennen oder Puten, 30.000 Masthähnchen, 1.500 Mastschweinen bzw. 560 Sauen um, aber auch mit einer Kumulierungsregel für Gemischtbetriebe.
Die Kommission schlägt jetzt die Einfügung eines „Sonderverfahrens“ in die Richtlinie für die Anforderungen von Stallbauten vor, das dann auch für die Rinderhaltung gelten soll. Bei einem Schwellenwert von 150 „livestock units“ wäre in Niedersachsen jeder durchschnittliche Milchviehbetrieb und auch kleine Schweine- und Geflügelhaltungen (ab 500 Mastschweinen, 300 Sauen (ohne jegliche Mast), 5.000 Hähnchen bzw. Puten oder gut 10.500 Legehennen) zukünftig nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz kurz BImSch-Verfahren zu genehmigen, zu betreiben und zu überwachen.
Jede bauliche Veränderung von bereits bestehenden Ställen auf den heutigen Höfen oberhalb dieser Größenordnung würde ein BImSch-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung auslösen, inklusive regelmäßiger Umweltinspektionen der Immissionsschutzbehörden der Landkreise. Im Unklaren lässt die EU-Kommission noch, wie man mit den bisher festgelegten „besten verfügbaren Techniken“ und den besonders strengen Umweltvorsorgeanforderungen zukünftig bei derartig kleinen Betrieben umgehen will. Das soll erst später in Durchführungsverordnungen festgelegt werden.
EU-Parlament und Ministerrat fordern Änderungen
Die Bemühungen des Verbandes, die Kommissionsvorschläge zu entschärfen, haben sich im Sommer 2023 ausgezahlt. Das EU-Parlament lehnte in seiner Stellungnahme zum Entwurf die Aufnahme der Rinder in die IED-Richtlinie ab und fordert die Beibehaltung der bisherigen Schwellenwerte bei Geflügel und Schweinen. Der Ministerrat geht in seiner Position leider nicht so weit, sondern befürwortet die Aufnahme von Rinderhaltungen mit mehr als 350 Großvieheinheiten, eine leichte Absenkung der Schwelle für die Sauenhaltung, fast die Halbierung bei Mastschweinen (ab 1.160 Mastplätze) und Legehennen (20.000) und eine Reduzierung um 75 Prozent auf etwa 9.300 Stallplätzen bei Puten.
Die Mitgliedstaaten wollen lediglich bei Masthähnchen den Schwellenwert von 40.000 Plätzen unverändert lassen. Die Rückmeldungen aus der Politik für die 2. Jahreshälfte 2023 lassen vermuten, dass Parlament, Ministerrat und Kommission sich bis Jahresende auf einen Kompromiss einigen werden. Daher hängt es jetzt vor allem am Durchsetzungsvermögen der vom Parlament bestimmten Verhandlungspartner ab, an die der Verband den Appell richtet, bei der Tierhaltung hart zu bleiben und diese nicht mit großen Industrieanlagen über einen Kamm zu scheren.


Artikel von
Hartmut Schlepps
stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Umweltreferent
Neue GAP-Förderperiode startet holprig
Zwar hatte der Bund es im Dezember 2022 noch rechtzeitig geschafft zum Beginn der neuen GAP-Förderperiode alle wesentlichen Gesetze und Verordnungen für die Durchführung in Deutschland zu erlassen, vielen Fragen zur konkreten Umsetzung aber sind auch nach fast einem Jahr noch nicht final beantwortet – geschweige denn zufriedenstellend aus Sicht des Berufstands.
Johannes Schürbrock
„In Niedersachsen wurden nur knapp 40 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel für die Ökoregelungen beantragt und das liegt daran, dass die Zugangsvoraussetzungen zu diesem Programm absolut nicht in den Betrieb hineinpassen und die Prämien zu niedrig sind. Ich bin mir sicher, dass diese Ökoregelungen ‚Ladenhüter‘ bleiben und keine ‚Verkaufsschlager‘ werden.“
Allein mehr als 30 Veranstaltungen im Frühjahr 2023, in der Regel jeweils länger als drei Stunden: Mit einem wahren Vortragsmarathon hat das Landvolk Niedersachsen – insbesondere in Person von Dr. Wilfried Steffens, der sich nach mehr als 30 Jahren als Referent für Agrarstruktur und Förderpolitik im Sommer 2023 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat – versucht, die neuen Regelungen den Landwirtinnen und Landwirten sowie den Beratenden verständlich zu machen und die zahlreichen Fragen zur ‚Neuen grünen Architektur der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)‘ rund um Konditionalität und Ökoregelungen zu beantworten.
Aber auch nach diesem Mammut-Programm laufen weiter Fragen beim Landesverband auf, insbesondere was die „Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen“, kurz GLÖZ, angeht. Neun Stück sind es an der Zahl. Dabei sorgen insbesondere die neuen Vorgaben bezüglich Gewässerabständen (GLÖZ 4), Mindestbodenbedeckung (GLÖZ 6), Fruchtwechsel (GLÖZ 7) und Stilllegung (GLÖZ 8) für allerhand Fragen und Verunsicherung: Muss auch an den regelmäßig trockenfallenden Gewässern der Abstand von drei Metern eingehalten werden? Reicht es für die Erfüllung der Mindestbodenbedeckung aus, bis zum 15. November auszusäen oder müssen schon Pflänzchen auf dem Feld zu sehen sein? Was zählt zur Grundgesamtheit der Ackerflächen, auf denen auf mindestens einem Drittel ein echter Fruchtwechsel stattfinden muss? Wann und womit dürfen GLÖZ 8-Brachen begrünt werden?
Manches lässt sich schnell unter Zuhilfenahme der Rechtstexte beantworten, manches bedarf der Klärung mit den Verwaltungsbehörden. Leider kommt es dabei auch vor, dass dabei unterschiedliche Aussagen zu Interpretation und Auslegungen von Regelungen seitens der Verwaltung vor Ort, den Länderministerien und dem Bundesministerium getätigt werden. In manchen Fällen wird wohl am Ende ein Verwaltungsgericht für Klarheit sorgen müssen.
Nachbesserung beim „aktiven Betriebsinhaber“
Dies wird hoffentlich bei der Definition zum „aktiven Betriebsinhaber“ als Grundvoraussetzung für den Erhalt der GAP-Förderung nicht nötig sein: Hier setzte sich das Landvolk Niedersachsen erfolgreich für eine rückwirkende Nachbesserung ein. Die ursprüngliche Definition – aktiver Betriebsinhaber ist derjenige, der Mitglied in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist – war zwar übersichtlich und unbürokratisch, das Sieb entgegen EU-rechtlichen Vorgaben aber doch zu grob. Mit konkreten Fällen von landwirtschaftlichen Betrieben aus Niedersachsen, die nicht in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung Mitglied sind, weil sie zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen, konnte das Grün geführte Landwirtschaftsministerium schnell dazu bewegt werden, die Definition noch einmal nachzubessern und zu erweitern. Mit der zweiten Verordnung zur Änderung der GAP-Direktzahlungen-Verordnung sollen nun auch rückwirkend zum 1. Januar 2023 Betriebe mit mindestens einer „sozialversicherungspflichtig-beschäftigten Arbeitskraft im landwirtschaftlichen Betrieb“ zum „aktiven Betriebsinhaber“ werden und an der GAP-Förderung partizipieren können.
Ökoregelungen bleiben im ersten Antragsjahr Ladenhüter
Vom Verband kritisch gesehen und kommentiert, ungeliebt bei der landwirtschaftlichen Praxis: Die Ökoregelungen als freiwillige einjährige Agrarumweltmaßnahmen in der ersten Säule der GAP wurden von den Landwirtinnen und Landwirten mehr schlecht als recht angenommen. Nur rund 60 % der bundesweit eingeplanten Mittel sind 2023 beantragt worden. Die Vorgaben sind vielfach praxisfern, die Prämien fallen zu gering aus. Auch wenn der Bund mit dem ersten Änderungsantrag zum deutschen GAP-Strategieplan nachsteuert, den Zugang zu den Ökoregelungen vereinfachen und die Prämien leicht erhöhen will, wird die Bereitschaft an den Ökoregelungen teilzunehmen, zumindest in Niedersachsen wohl nicht deutlich steigen. Über den Deutschen Bauernverband versucht das Landvolk Niedersachsen den Bund hier zu deutlichen Verbesserungen und attraktiveren Angeboten, insbesondere für Milchvieh- und Grünlandbetriebe, zu bewegen – bislang jedoch vergeblich.
ELER-Programm bleibt attraktiv, Kürzungen in der GAK
Deutlich besser angenommen werden erfahrungsgemäß die Förderangebote der zweiten Säule der GAP, wobei hier der Start ebenfalls deutlich besser hätte laufen können. Auch aufgrund der allgemeinen Verzögerung – die Förderperiode sollte dem ursprünglichen Plan nach bereits 2021 starten – liegen zum Redaktionsschluss noch nicht alle Förderrichtlinien für die Maßnahmen aus dem Landesprogramm KLARA (Klima.Landwirtschaft.Artenvielfalt.Regionale Akteur:innen) vor. So wird beispielsweise die Förderung der Mehrgefahrenversicherung, die helfen soll durch Klimaerwärmung zunehmenden Risiken bei Anbau und Ernte abzusichern, nach derzeitig Stand erst für das Anbaujahr 2025 zur Verfügung stehen.
Finanziert wird KLARA mit Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), wobei Bund und Länder die Maßnahmen kofinanzieren müssen. Hierfür werden regelmäßig Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) verwendet. Entgegen der Absichtsbekundung im eigenen Koalitionsvertrag wollen Ministerinnen und Minister des Bundeskabinetts die Mittel der GAK nicht aufstocken, sondern drastisch kürzen. Um rund ein Viertel soll der Bundes-Etat in diesem Bereich zusammengestrichen werden, und die Sonderrahmenpläne „Förderung der ländlichen Entwicklung“ und „Ökolandbau und biologische Vielfalt“ ab 2024 gleich ganz wegfallen, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann.
Damit stünden allein vom Bund etwa 300 Millionen Euro weniger zur Verfügung. Zum Redaktionsschluss waren die Haushaltsverhandlungen im Bundestag nicht abgeschlossen, die Auswirkungen möglicher GAK-Mittelkürzungen auf das niedersächsische Förderangebot daher noch nicht final absehbar. Der Deutsche Bauernverband hat die Kürzungen deutlich kritisiert und Nachbesserungen eingefordert.



Artikel von
Hendrik Gelsmann-Kaspers
Referent für Strukturpolitik
- Verbände kämpfen gemeinsam für die Zukunft der heimischen Landwirtschaft
- Europäische Umweltpolitik I: Landvolk organisiert Verbändeinitiative zu Pflanzenschutzverboten der EU-Kommission
- Europäische Umweltpolitik II: Umsetzungspläne zur Verbesserung der Biodiversität hoch umstritten
- Europäische Umweltpolitik III: BImSch-Verfahren zukünftig für jeden Stall?
- Neue GAP-Förderperiode startet holprig