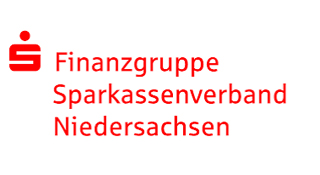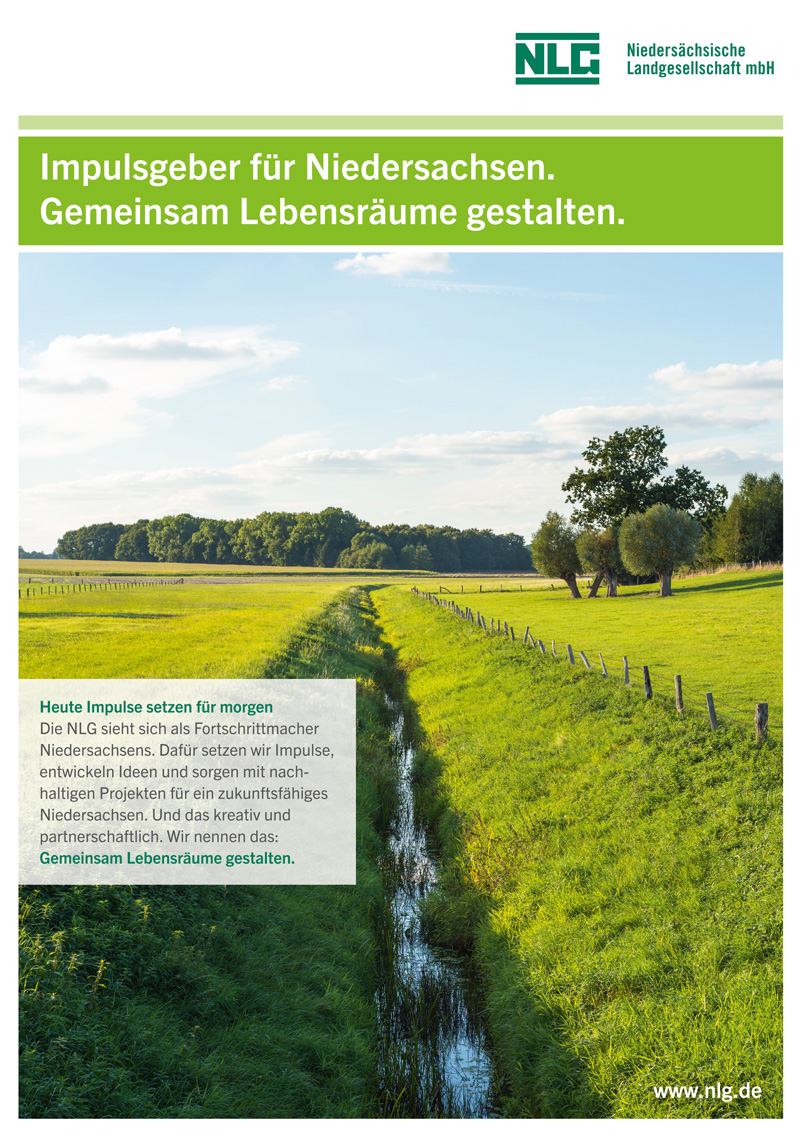Agrarrecht
Rechtsdienstleistung ist Privileg berufsständischer Organisationen
Es besteht zugunsten beruflicher Vereinigungen und ihrer Zusammenschlüsse ein Rechtsberatungsprivileg. Davon machen die Landvolkkreisverbände in unterschiedlicher Weise Gebrauch und bieten ihren Mitgliedern Rechtsdienstleistungen unterschiedlicher Qualität an. Diese erstreckt sich von einer Beratung im Bereich des „klassischen“ Agrarrechts, dem Pacht- und Höferecht, über genehmigungs- und planungsrechtlichen Themen bis hin zur Klärung rechtlicher Fragen in der Unternehmensberatung.

Harald Wedemeyer
„Im Dezember 2022 ist das Strompreisbremsegesetz in Kraft getreten, mit dem der Strompreis gedeckelt werden sollte. In einem Kraftakt ist es dem landwirtschaftlichen Berufsstand und der Bioenergiebranche mit der Unterstützung vieler Politiker und Minister gelungen, dass Biogasanlagen mit einer Bemessungsleistung von einem Megawatt (MW) von den Regelungen ausgenommen wurden.“
Der Landesverband unterstützt dabei die Kreisverbände auf unterschiedliche Weise. So werden Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für das Personal, das die Mitglieder in rechtlichen Angelegenheiten berät, durchgeführt. Dabei sind insbesondere die vier Mal im Jahr durchgeführten Rechtstage hervorzuheben, die auch von der Rechtsanwaltskammer als Fortbildungsveranstaltung für den Fachanwalt für Agrarrecht anerkannt sind. Zudem haben die Kreisverbände Zugriff auf eine Kommunikationsplattform und Rechtsdatenbank, in der unter anderem aktuelle Informationen, gerichtliche Entscheidungen und Rechtstexte eingestellt werden. Der Landesverband seinerseits wird wiederum vom Deutschen Bauernverband unterstützt, indem bundesrechtliche Themen für die Landesverbände aufbereitet werden.
Mediation auf dem Vormarsch
Die Bedeutung der Mediation im Bereich der Konfliktbewältigung, aber auch als ergänzendes Instrument der Rechts- und Steuerberatung nimmt zu. Auch hier werden sowohl Kommunikationsmöglichkeiten als auch Fortbildungsveranstaltungen in Kooperation mit dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) organisiert. 2023 wurde insbesondere die Entwicklung von Mediationsdienstleistungen durch die Landesbauernverbände Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, Bayrischer Bauernverband (BBV) und Landvolk Niedersachsen intensiviert. Für 2024 sind gemeinsame Fortbildungen geplant, zudem wird im Herbst eine zentrale Veranstaltung für berufsständische Mediatoren in Kassel stattfinden.
Herausragende Rechtsthemen: Pflanzenschutzmittel-Kartell, Freiflächenphotovoltaik und Landesdüngeverordnung
Auch 2023 hat der Landvolkverband Mitglieder, die ihren Schaden gegen die Kartellanten des Pflanzenschutzmittelkartells (PSM-Kartell) geltend machen wollten, unterstützt. Nach dem die eigens dazu eingerichteten Website geschlossen worden war, lebte das Interesse der Mitglieder an der Geltendmachung des kartellrechtlichen Schadensersatzes wieder auf als im August 2022 der Rechtsdienstleister Uni Legion aus München den Beitritt zu ihrer Klagegemeinschaft massiv bewarb. Dem starken Beratungsaufkommen begegnete das Landvolk Niedersachsen mit einer erneuten Freischaltung der Website bis zum Juni 2023.
Interessierte Landwirte können aber weiterhin über die Kreisverbände der Klägergemeinschaft beitreten. Der Kostenrisiko tragende Rechtsdienstleister TransAtlantic bietet den registrierten Landwirten einen Forderungskauf in Höhe von 22 Prozent des festgestellten Schadens an, der für Landwirte interessant sein kann, die akute Liquiditätsengpässe haben. Wer warten kann, sollte an der Klage festhalten, zumal sich über diesen Weg – wenn die Gerichte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) folgen und die nationalen Verjährungsregelungen als nicht beachtlich ansehen – ein noch höherer Schaden als der für den Verjährungszeitraum festgestellte – durchsetzen lassen kann.
Die aktive Unterstützung der Landwirte durch das Landvolk, ihren Schaden auf dem Klagewege geltend zu machen, wurde von den Mitgliedern sehr positiv aufgenommen.
Politische Ausbauziele befeuern das Interesse an PV-Freiflächenanlagen
Nunmehr sieht der Änderungsentwurf zum Niedersächsischen Klimaschutzgesetz (NKlimaSchG) vor, dass bis 2033 auf mindestens 0,5 Prozent der Landesfläche (23.807 Hektar) Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) zu errichten sind. Der Bund strebt bis 2030 den Ausbau von derzeit knapp 60 auf 215 Gigawatt (GW) und bis 2040 auf 400 GW an, um damit auch erhebliche Mengen grünen Wasserstoffs als saisonalen Speicher erzeugen zu können.
Dies erzeugt einen erheblichen Druck auf landwirtschaftliche Flächen. Daher sieht der Kabinettsentwurf des „Solarpakets 1“ einen Solardeckel bis Ende 2030 in Höhe von 80 GW für Freiflächenanlagen vor und darüber hinaus 177,5 GW. Bei Erreichen dieser Schwellenwerte sind auf Gebote für Freiflächenanlagen keine Zuschläge zu erteilen.
Im Solarpaket sind noch Regelungen zur Biodiversitäts-Photovoltaik enthalten und auch zur extensiven Agri-Photovoltaik. Hier muss sich zeigen, ob sich diese Ansätze in der Praxis durchsetzen werden.
Insgesamt ist festzustellen, dass aufgrund der gestiegenen Anlagenpreise die Renditeaussichten geschmälert sind. Weiterhin zeichnet sich ab, dass künftig zubaubedingt hohe, die Nachfrage überschreitende Überschussstrommengen am Markt die Strompreise bis in den negativen Bereich drücken werden. Da eine Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu negativen Strompreisen nach EU-Recht – konsequenter Weise – verboten ist, wurde im Dezember 2022 das Erneuerbare Energiengesetz (EEG) dahingehend angepasst, dass eine EEG-Förderung ab 2027 bereits dann entfällt, wenn der Strompreis am Spotmarkt über mehr als eine Stunde negativ ist (derzeit sind es vier Stunden, in 2024 drei Stunden und 2025 sowie 2026 zwei Stunden).
Somit wird es künftig für einen wirtschaftlichen Betrieb von Wind- und Solaranlagen unerlässlich sein, in Speichertechnologien zu investieren. Daher ist bereits jetzt bei der Standortfindung die Integration der geplanten Anlage in ein Stromerzeugungs- und Speichersystem zu berücksichtigen, um Fehlallokationen und -investitionen zu vermeiden. Darauf weist das Landvolk Niedersachsen bei der Beratung von Mitgliedern ausdrücklich hin.
Landvolk klagt gegen Landesdüngeverordnung
Mit Verordnung vom 8. Februar 2023 ist die Landesdüngeverordnung 2021 geändert und an die Vorgaben der 2022 geänderten Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung-AVV GeA) angepasst worden. Die gegen die Landesdüngeverordnung 21 auf Empfehlung des Fachbüros HYDOR ausgesuchten und erhobenen sieben Normenkontrollklagen (gemeinschaftlich vom Landesverband und den Kreisverbänden finanziert) werden – mit geändertem Klageantrag – weitergeführt. Zusätzlich werden noch drei Normenkontrollklagen in Absprache mit dem Gutachter Dr. Stephan Hannappel erhoben.
Zum Herbst steht noch eine weitere Änderung an, die die Denitrifikation berücksichtigt. Hier wird nach Veröffentlichung der Verordnung nach fachlichen Kriterien über mögliche Rechtsmittel entschieden.
Gesetzespakete zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur Bewältigung der Gasmangellage
Aus der Vielzahl an neuen Regelungen seien hier – exemplarisch – folgende dargestellt:
Um der Gasmangellage zu begegnen sind eine Reihe von gesetzlichen Regelungen in Kraft getreten. So unter anderem das Energiesicherungsgesetz, mit dem es Biogasanlagen ermöglicht wird, mehr Gas zu erzeugen. Hier ist beispielsweise die Höchsterzeugungsmenge von 2,3 Normkubikmeter (Nm3) des Bauplanungsrechts (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) bis Ende 2024 aufgehoben worden oder es sind entsprechende Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) geändert worden.
Im Dezember 2022 ist das Strompreisbremsegesetz in Kraft getreten, mit dem der Strompreis gedeckelt werden sollte. In einem Kraftakt ist es dem landwirtschaftlichen Berufsstand und der Bioenergiebranche mit der Unterstützung vieler Politiker und Minister gelungen, dass Biogasanlagen mit einer Bemessungsleistung von einem Megawatt (MW) von den Regelungen ausgenommen wurden.
Weiterhin sind Agri-PV Anlagen auf einer Fläche von 2,5 ha in räumlich-funktionalen Zusammenhang zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Außenbereich privilegiert zulässig (§ 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB). Zu Jahresbeginn sind PV-Freiflächenanlagen innerhalb eines Streifens von 200 Metern neben der Bundesautobahn und zweigleisigen Schienenwegen in die Privilegierung aufgenommen worden (§ 35 Abs. 1 Nr. 8b). Allerdings haben die Kommunen keine Möglichkeit der Steuerung, da diese Vorschrift nicht in den so genannten Planungsvorbehalt aufgenommen worden ist.
Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden fordern wir die Aufnahme dieser Vorschrift in den Planvorbehalt nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Vielen Kommunen stehen vor dem Problem, dass die neue Privilegierungsvorschrift ihren Planungen zuwiderläuft. Dort muss, insbesondere mit Blick auf einen geordneten Ausbau, der auch die Speicherstandorte berücksichtigt, dringend nachgebessert werden.
Nutzungsverträge Solar und Wind sowie GAP-Beratung
Ein weiterer Schwerpunkt der Beratung auf Kreis- und Landesebene lag im Bereich der Nutzungsverträge, mit denen das Recht der Grundstücksnutzung für Errichtung und Betrieb von Wind- und Solaranlagen eingeräumt wird und im GAP-Bereich. Exemplarisch seien hier die Junglandwirteprämie und Glöz 8 genannt.



Artikel von
Harald Wedemeyer
Rechtsreferent und Referent für Erneuerbare Energien
Niedersachsen im Fokus von Höchstspannungsstromleitungs- und Gasfernleitungs-Infrastrukturvorhaben
Das was auf Deutschland und speziell Niedersachsen zukommen wird, wird im Netzentwicklungsplan Strom 2037/ 2045 und im Netzentwicklungsplan Gas 2022 – 2032 deutlich. Im Höchstspannungsbereich benötigen wir laut der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) das ausgebaute sogenannte „Klimaneutralitätsnetz“ bereits im Jahre 2037. Die 16 Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) im Gasleitungsbereich verfolgen in ihrem Netzentwicklungsplanentwurf unter anderem die Zielrichtung ein Wasserstoffkernnetz bis zum Jahr 2032 zu schaffen.
Durch die Vielzahl an neu vorgesehenen großen Leitungsbauvorhaben, welche in den Netzentwicklungsplänen verankert sind, lässt sich die Dimension der Betroffenheit von Grundeigentümern und Bewirtschaftern landwirtschaftlicher Flächen ablesen. Niedersachsen befindet sich durch seine geografische Nordseeküstenlage daher im Fokus der Erschließung der Offshore-Windparks im Wattenmeer und der LNG-Terminals Wilhelmshaven, Stade und Brunsbüttel. Die anlandende Energie muss über Leitungen zu den Verbrauchspunkten und im Schwerpunkt in die Industriezentren Deutschlands transportiert werden.
Immenser Netzausbau mit enormer Betroffenheit von landwirtschaftlich genutzten Flächen
Wie ambitioniert die derzeitigen politischen Zielsetzungen beim Ausbau sind, zeigt sich zum Beispiel am Windenergie-auf-See-Gesetz, wo die Voraussetzungen geschaffen wurden, dass bis zum Jahr 2030 die installierte Leistung von Offshore-Windenergie auf mindestens 30 Gigawatt und bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt steigen soll. In Anbetracht der Offshore-Leistung in Nord und Ostsee zum Halbjahr 2023 von etwa 8,4 Gigawatt werden die enormen Größenordnungen ersichtlich. Für jede ausgebaute Gigawattstunde werden gleichzeitig Höchstspannungsleitungen in identischer Größenordnung notwendig.
Das bedeutet speziell für die besonders betroffenen Nordseeküstenregionen aber auch für das niedersächsische Binnenland, dass ein immenser weiterer Netzausbau mit enormer Betroffenheit von in erster Linie landwirtschaftlich genutzten Flächen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit einer Vielzahl von weiteren Herausforderungen bevorsteht.
Das Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e.V. konstatiert, dass die von der Bundesnetzagentur und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bestätigten Leitungsbauvorhaben Gesetzesrang eingeräumt bekommen und daher muss der Landesverband von der Realisierung dieser Leitungsbauvorhaben, beispielsweise gemäß Bundesbedarfsplangesetz im Höchstspannungsleitungsbau, ausgehen. Für die Realisierung derartiger Höchstspannungsleitungen und Gasfernleitungen bestehen überdies hoheitliche Besitzeinweisungs- und Enteignungsrechte.
Jedem betroffenen und belasteten Grundeigentümer und Bewirtschafter empfiehlt das Landvolk Niedersachsen, sich in die Genehmigungsverfahren einzubringen und zu den jeweiligen Eingriffen und Härten vorzutragen.
Gleichwohl vertritt der Berufsstand die Auffassung, dass er für die vorhabenbetroffenen Mitglieder die bestmögliche Unterstützungsleistung in Form von Rahmenvereinbarungsabschlüssen der Kreisverbände mit den jeweiligen Vorhabenträgern erbringen kann.
Aufgrund der großen Anzahl an derzeit laufenden Rahmenvereinbarungsverhandlungen mit unterschiedlichen Vorhabenträgern im Höchstspannungsleitungsbereich und Fernleitungsgasbereich soll an dieser Stelle lediglich auf zwei abgeschlossene Rahmenvereinbarungen im vergangenen Jahr näher eingegangen werden.
Unter Verhandlungsführerschaft und Gesamtkoordinierung des Landvolks Niedersachsen konnte im Dezember 2022 die Suedlink-Rahmenvereinbarung für das bis dato größte Höchstspannungserdkabelvorhaben in Deutschland mit den Übertragungsnetzbetreibern Tennet TSO und TransnetBW abgeschlossen werden. Diese Rahmenvereinbarung ist als Empfehlung gegenüber der vorhabenbetroffenen Mitgliedschaft zu verstehen.
Neben einem vollständigen Ausschöpfen der Entschädigungsregelungen des § 5a StromNEV konnten insbesondere bei den Flur-, Aufwuchs-, und Folgeschäden sowie im Bereich der Wirtschaftserschwernisse und Bodenschutzregelungen und so weiter tragfähige Regelungsinhalte erzielt werden, welche das zukünftige Fundament im Bereich der Stromerdkabelleitungen bilden dürfte.
Auch bei dem Abschluss dreier Rahmenvereinbarungen für Freileitungshöchstspannungsvorhaben rund um Conneforde hat das Landvolk Niedersachsen unterstützend an der Seite der betroffenen Kreisverbände gestanden und mit dem ÜNB Tennet akzeptable Rahmenvereinbarungsinhalte verhandelt.
„Zukunftsvereinbarung Netzausbau Niedersachsen“ als Grundlage für kommende Erdkabel- und Freileitungsvorhaben
Diese jüngst abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen bilden die Grundlage für die laufenden Verhandlungen mit dem Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO, welcher in Niedersachsen überwiegend für den Höchstspannungsnetzausbau zuständig ist. Das Landvolk Niedersachsen will die sogenannte „Zukunftsvereinbarung Netzausbau Niedersachsen“ als Grundlage für die Vielzahl noch kommender Erdkabel- und Freileitungsvorhaben in Niedersachsen gemeinsam mit dem ÜNB als Musterrahmenvereinbarung entwickeln.
In dieser von beiden Seiten angestrebten „Zukunftsvereinbarung“ werden Regelungslösungen unter anderem für die Thematiken naturschutzrechtliche Kompensationsflächen, Trassenbündelung, Verkehrswertfestlegungen und Regelungen für Bewirtschafter erarbeitet, welche über bisherige Regelungsinhalte und Reglungstiefen hinausgehen.
Abschließend sei an dieser Stelle das unterschiedliche Entschädigungs- und Regulierungsniveau zwischen Höchstspannungserdkabelleitungen im Vergleich zu Gasfernleitungen genannt. Bei beiden Leitungstypen handelt es sich um Erdkabel, welche in einer vergleichbaren Verlegetiefe mit nahezu identischen Schutzstreifenbreiten mittels offener Verlegeweise verlegt werden.
Warum nun bei der Entschädigungszahlung pro Quadratmeter Schutzstreifen bei der Gasfernleitung lediglich 20 Prozent des Verkehrswertes gezahlt werden soll und bei Höchstspannungserdkabelleitungen immerhin 35 Prozent des Verkehrswertes für die in Anspruch genommene Schutzstreifenfläche, sieht das Landvolk Niedersachsen als äußerst problematisch an, um nur einen gravierenden Unterschied zu nennen.
Gegebenenfalls werden diese zum Teil erheblichen Differenzen nur auf politischem Wege gelöst werden können.
Bis dato wird das Landvolk Niedersachsen in den Verhandlungen mit Fernleitungsnetzbetreibern, beispielsweise mit dem Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie, gemeinsam mit den betroffenen Kreisverbänden weiterhin für tragfähige Rahmenvereinbarungsinhalte und Konditionen eintreten und prangert den nicht begründbaren Unterschied gegenüber den Fernleitungsnetzbetreibern im Sinne der vorhabenbetroffenen Mitgliedschaft an.


Artikel von
Rüdiger Heuer
Rechtsreferent
Düngerecht: Befreiungsschlag lässt auf sich warten
Die Tierhaltung und damit auch regionale Nährstoffüberschüsse nehmen ab, behördliche Nährstoffberichte belegen, dass über die aktuelle Stickstoffversorgung von Kulturpflanzen und Böden kaum noch die Bedarfswerte der Düngeverordnung erreicht werden und der Mineraldüngerabsatz weiter kontinuierlich auf eine Menge zurückgeht, die man zuletzt Ende der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts bei deutlich geringeren Erträgen ausgebracht hat.
Karsten Padeken
„Bund und Länder müssen so schnell wie möglich die Ökoregelungen nachbessern, damit auch Milchviehhalter durch attraktive Maßnahmen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Prinzipiell muss unsere Arbeit für den Umweltschutz besser honoriert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Weidehaltungsförderung.“
Und dennoch waren die Betriebe in 2022/23 durch eine zweimalige Änderung der Kulisse der „roten Gebiete“ betroffen, die in Niedersachsen wegen eines angeblich nicht ausreichend flächendeckenden Netzes an nutzbaren Grundwassermessstellen jetzt möglicherweise jahrelang nach einer Grenzlinienberechnung zwischen „roten“ und „grünen“ Messstellen erfolgt (IDW-Interpolation). Dieses Verfahren ist ohne jeglichen Bezug zu den natürlichen Einwirkungen auf die Nitratbelastungen und deren Verteilung im Grundwasser wie die Grundwasserfließrichtung, die Bodenarten (Ton, Lehm, Moor, Marsch, Sand), die regionalen N-Überschüsse oder die Nutzung (Wald, Acker, Grünland usw.). Die ermittelten Grenzlinien zwischen „rot“ und „grün“ hängen ausschließlich von der Höhe der gemessenen Werte und der Entfernung der Messpunkte (Messtellen) ab.
Das Prozedere gipfelte dann im Juli in einer Neuabgrenzung unter Berücksichtigung der so genannten „Denitrifikation“ im Grundwasser, die aber auf Basis von wenigen Einzeluntersuchungen erfolgte und schon daher vom Landvolk Niedersachsen nicht akzeptiert werden kann. Glücklicherweise tritt diese zweite Änderung der Gebietskulisse, die zu einer landesweiten Ausweitung der Betroffenheit von zuletzt gut 20 auf dann 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche führt, erst zum Spätherbst ein und vermeidet damit eine zweimalige bürokratische Anpassung der Düngebedarfsberechnungen und Ausbringungsobergrenzen innerhalb eines Jahres.
Gleichwohl ist die Praxis zutiefst frustriert, auch weil momentan noch kein konkretes Zeitziel für die politisch stets zugesagten Erleichterungen für besonders gewässerschonend wirtschaftenden Betriebe genannt wird und obwohl die EU-Kommission das Vertragsverletzungsverfahren inzwischen eingestellt hat. Die detaillierten Stellungnahmen des Landesverfahrens stoßen nach erkennbaren Erfolgen unter der alten Landesregierung inzwischen wieder weitgehend auf „taube Ohren“. Die Kreisverbände haben dazu inzwischen ein weiteres Gutachten des Ingenieurbüros „Hydor“ zum Verfahren und zu bisher nicht untersuchten neuen „roten“ Messstellen eingeholt. Der Gutachter bestätigt darin seine vernichtende Bewertung bezüglich der normgerechten Einrichtung solcher Messstellen.
Für den Landesverband ist es angesichts dieser Situation unverzichtbar, dass jetzt auch gerichtlich geklärt wird, ob die Betroffenen bis 2029 mit dem fachlich offensichtlich völlig ungeeigneten Abgrenzungsverfahren nach der IDW-Interpolation auf Basis eines absolut zweifelhaften Messstellennetzes hingehalten werden können bis dann bundesweit das geostatistische Verfahren vorgeschrieben ist. Durch das IDW-Verfahren werden inzwischen mehr als 170.000 Hektar Dauergrünland vom Land als „nitratbelastet“ eingestuft, ein fachlich unhaltbares Ergebnis. Daher erwartet der Verband entsprechend der zugesagten, verursachergerechten Umsetzung von Düngebeschränkungen, als ersten Schritt die Herausnahme des Dauergrünlands aus der Deckelung der Stickstoffausbringung auf 80 Prozent des berechneten Bedarfs.
Auf Bundesebene ist ein neues Düngegesetz angekündigt, dass über Ländergrenzen hinweg die Datenbereitstellung für das von der EU geforderte Monitoring regeln soll, die Details und Kompatibilität mit dem niedersächsischen „ENNI-System“ sind noch unklar. Parallel zur gerichtlichen Klärung, die vom Verband intensiv unterstützt wird, drängt das Landvolk Niedersachsen bei jeder sich ergebenden Gelegenheit auf eine Gesamtrevision des Düngerechts, bei der neben einer Entbürokratisierung (z. B. Ersatz schlagbezogener Dokumentationen und Meldepflichten durch gesamtbetriebliche Betrachtungen) auch praxisgerechte Nachweise der gewässerschonenden Bewirtschaftung zwecks Flexibilisierung der starren Begrenzungen in roten Gebieten eingeführt wird.
Niedersächsischer Weg: Schritt für Schritt in der konkreten Umsetzung
Detailarbeiten standen 2023 auch beim „Niedersächsischen Weg“ im Vordergrund der regelmäßigen Beratungen von Niedersächsischem Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK), Landvolk Niedersachsen, Naturschutzbund Deutschland (NABU) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der beihilferechtliche Rahmen konnte zu großen Teilen geklärt werden, jetzt wird es spannend, in welchem Umfang die von Gewässerrandstreifen betroffenen Landwirte ihren Ausgleichsanspruch bei der dafür zuständigen Landwirtschaftskammer geltend machen. Mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium wurde ein Weg erörtert, wie Niedersachsen eine weitgehende Kompatibilität des Landeswasserrechts mit den Anforderungen an Pufferstreifen im Rahmen der GAP-Konditionalität herstellen kann.
Leider bedarf es dazu noch einer gesetzlichen Korrektur im Niedersächsischen Wassergesetz, die für Anfang 2024 angestrebt wird. Die so genannte Biodiversitätsberatung, für die die LWK Niedersachsen federführend ist, konnte personell verstärkt werden, aber es fehlt noch an spürbarer Wirksamkeit in der Praxis.
Das trotz des Regierungswechsels die Kontinuität beim Niedersächsischen Weg erhalten bleiben soll, wurde von allen Beteiligten auf den Feldtagen der LWK Niedersachsen in Poppenburg eindrucksvoll demonstriert. Wenig überzeugend ist leider der bisherige Fortschritt im beschlossenen Wiesenbrüterschutzprogramm. Hier sieht das Landvolk das Umweltministerium in der Pflicht, „eine Schippe draufzulegen“, was den möglichst baldigen Start des Programms betrifft. Nicht abschließend beendet ist auch noch der Stand der Diskussion über die Anerkennungen von Leistungen der Landwirtschaft im Rahmen der Biotopvernetzung und deren Bilanzierung.
Hubertus Berges
„Wasserschutz und Klimaschutz – das sind die aktuellen Themen, mit denen wir uns im Umweltausschuss am intensivsten beschäftigen. Wir befürchten, dass wir in den roten Gebieten durch eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Unterdüngung der Pflanzen eher Humus abbauen als aufbauen. Und das ist in Zeiten des Klimawandels kontraproduktiv.“
Wassermengenmanagement im Zeichen des Klimawandels
Immer mehr Landkreise sehen sich gezwungen, in den Sommermonaten ordnungsrechtliche Regelung zur Reduzierung eines vermeidbaren Wassergebrauchs zu treffen, die nicht nur den privaten Gebrauch betreffen, sondern leider zunehmend auch die Bewässerungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Kulturen einschränken. Daraus droht sich auch eine Diskussion zu landeseinheitlichen Vorgaben und Festlegung von Auslöseschwellen solcher Einschränkungen zum Beispiel in Abhängigkeit von Pegelständen an Grundwassermessstellen zu entwickeln.
Angesichts der großen regionalen Unterschiede hinsichtlich der naturräumlichen Gegebenheiten und des Umfangs an Grundwassernutzungen besteht bei Festlegungen auf Landesebene vor allem für die Landwirtschaft die Gefahr, dass eine Vereinheitlichung zu weniger sachgerechten Lösungen führen wird als ein regional abgestimmtes Vorgehen.
Einer Polarisierung, die zum Beispiel von der Forderung der Wasserwirtschaftsverbände nach einem pauschalen gesetzlichen Vorrang des Wasserbedarfs der Träger der öffentlichen Wasserversorgung ausgeht, muss die Politik entschieden entgegentreten. Politische Aufgabe ist es stattdessen, einen breiten gesellschaftlichen Konsens unter allen Akteuren herzustellen, die für ihre wirtschaftlichen Zwecke die natürlichen Wasserressourcen nutzen, dass die Anpassung an klimawandelbedingte, negative Auswirkungen auf verfügbare Wasserressourcen durch alle Beteiligten erfolgen muss und sich niemand aus der Verantwortung stehlen kann.
Auf der anderen Seite fordert das Landvolk Niedersachsen die Politik aber auch auf, die Klimawandelanpassung in diesem Bereich massiv durch administrative und finanzielle Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der verfügbaren natürlichen Wasserressourcen zu unterstützen. Als Stichwort sind hier Systeme zur Rückhaltung von Niederschlagswasser in der Fläche und zur Grundwasseranreicherung durch Versickerung hinreichend gereinigtem Brauchwasser zu nennen.
Erste Überlegungen des Niedersächsischen Umweltministeriums über die weitere Umsetzung des so genannten Wasserversorgungskonzeptes zeigen aktuell auf, dass die Errichtung von neuen Strukturen zur regionalen Beteiligung schnell möglich wäre. Aber auch in diesem Bereich nützt die beste regionale Beteiligung und Abstimmung des Bedarfs nicht, wenn die nötigen Finanzmittel für die Umsetzung von Maßnahmen nicht bereitstehen.


Artikel von

Hartmut Schlepps
Umweltreferent

Dr. Nataly Jürges
Umweltreferentin
Klimaschutz im Moorland Niedersachsen - Too big to fail?
2023 zeigte sich einmal mehr, dass in allen Produktionsrichtungen die zukünftige Entwicklung der niedersächsischen Landwirtschaft davon abhängen wird, wie das unumstrittene Ziel der schnellen Verringerung von Treibhausgasemissionen und die dringend notwendigen Klimawandelanpassungsmaßnahmen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zur Umsetzung kommen.
Die Minderung der Emissionen von kohlenstoffreichen (Moor)Böden ist dabei eine der größten Herausforderungen neben der Frage der Wasserverfügbarkeit für ertragreichen Pflanzenbau. Leider fehlte es jedoch der Politik auch in diesem Jahr an Mut und Ideen, wie zum Beispiel eine zukunftsfähige Landwirtschaft und die dazu notwendige Anpassung der Betriebe auf den Moorstandorten unter dem Zwang einer massiven Emissionsminderung zum Beispiel durch Grundwasseranhebungen und Wiedervernässungen erreicht werden kann.
Immer höhere Klimaschutzziele ohne konkrete Pläne zur Umsetzung
Im Jahr 2021 hat die Bundesregierung das Bundesklimaschutzgesetz novelliert und erstmals konkrete Ziele für den Klimaschutzbeitrag der Landökosysteme festgelegt. Der Klimaschutzbeitrag der Landökosysteme wird über die Emissionsbilanz des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (Land Use, Land Use Change and Forestry; LULUCF) erfasst. Bis zum Jahr 2030 sollen jedes Jahr 25 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent (t Äq.) mehr aus der Atmosphäre entnommen und dauerhaft gespeichert werden, als Treibhausgase in diesem Sektor emittiert werden – beispielsweise aus entwässerten Moorböden. Bis zum Jahr 2045 beträgt das jährliche Ziel minus 40 Mio. t CO2-Äq. Diese Maßeinheit vereinheitlicht die Klimawirkung verschiedener Treibhausgase, neben CO2 beispielsweise auch Methan oder Lachgas.
Ob dieses neue Klimaziel erreicht werden kann, ist jedoch aktuell sehr fraglich. Im Jahr 2022 betrugen die Emissionen des LULUCF-Sektors in Deutschland lediglich minus 1,8 Mio. t CO2 Äq.. In Niedersachsen war der LULUCF-Sektor sogar ein Nettoemittent, die Kohlenstoffspeicherung in den Wäldern kann aktuell die Treibhausgasemissionen durch entwässerte Moorböden nicht ausgleichen. Gleichzeitig verschlechtert sich der Zustand der heimischen Wälder durch den Klimawandel immer mehr. Stürme, Dürren und Borkenkäfer bedrohen die Kohlenstoffspeicherung in den Wäldern.
Die Nationale Moorschutzstrategie sieht eine jährliche Reduzierung der Emissionen durch entwässerte Moore bis zum Jahr 2030 um fünf Mio. t CO2-Äq. vor. Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen, hat die Bundesregierung im März 2023 das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) beschlossen. Natürlicher Klimaschutz zielt darauf ab, die Biodiversität zu erhalten und gleichzeitig die Klimaschutzwirkung von Ökosystemen zu stärken.
Zentraler Baustein des ANK ist es, Maßnahmen zur Emissionsminderung auf Moorböden durch Wiedervernässung zu erreichen. Im Jahr 2021 hatten der Bund und die Länder eine Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz abgeschlossen. Niedersachsen hat als seinen Beitrag im aktuellen Entwurf zur Novellierung des Niedersächsischen Klimagesetzes eine Minderung der jährlichen Treibhausgasemissionen aus organischen Böden bis zum Jahr 2030 um 1,65 Mio. t vorgesehen.
Die Bauernfamilien in den Moorregionen sind von diesen Plänen daher besonders betroffen: In Niedersachsen sind 27 Prozent der kohlenstoffreichen Böden Äcker und 54 Prozent Grünland. Gleichzeitig befinden sich auch viele Siedlungen auf den ehemaligen Moorflächen und außerlandwirtschaftliches Gewerbe hat sich dort angesiedelt, oft stark abhängig als vor- oder nachgelagerter Bereich der landwirtschaftlichen Primärerzeugung. Zehntausende von Arbeitsplätzen drohen in diesen Regionen wegzufallen, wenn keine Alternativen zur Verdrängung der bisherigen Produktion, die bei einer vollständigen Wiedervernässung unvermeidbar wäre, gefunden werden.
Wie die ambitionierten Klimaziele des Bundes und des Landes Niedersachsen erreicht werden sollen, ist aktuell komplett unklar. Noch gibt es keine konkreten Pläne oder langfristigen Maßnahmen, mit denen die Ziele erreichbar wären. Die Politik setzt zu Recht auf Freiwilligkeit, doch es fehlt bislang an aussichtsreichen Entwicklungen und dafür ausgerichtete Förderangebote.


Die Zukunft der niedersächsischen Landwirtschaft auf Moorstandorten
Aktuell mangelt es an wirtschaftlichen Alternativen zur Grünland- und Ackernutzung. Paludikulturen, die landwirtschaftliche Nutzung von vernässten organischen Böden, wird von der Politik als Zukunftsvision für die Landwirtschaft in der Küstenregion propagiert. Dabei wird der oberirdische Aufwuchs, beispielsweise Rohrkolben oder Schilf, als nachwachsender Rohstoff verwertet. Bislang fehlt es jedoch an funktionierenden Wertschöpfungsketten für Rohstoffe aus Paludikulturen. Zusätzlich ist wissenschaftlich noch nicht geklärt, ob es überhaupt möglich ist, auch ohne erheblichen Einsatz von Düngemitteln langfristige Erträge aus Paludikulturen zu erzielen.
Unser Nachbarland Niederlande konzentriert sich aktuell darauf, neue technische Möglichkeiten zu erforschen, um Moore teilweise wiederzuvernässen und gleichzeitig Milchviehwirtschaft zu ermöglichen. In Niedersachsen wird ein ähnlicher Ansatz in einem Pilotprojekt im Gnarrenburger Moor verfolgt. Jedoch wäre noch viel mehr Forschung und staatliche Unterstützung notwendig, um schnell wirtschaftlich tragfähige Alternativen für die Zukunft der Landwirtschaft auf Moorstandorten zu entwickeln und umzusetzen.
Das Landvolk Niedersachsen hat sich daher im August 2023 sehr kritisch gegenüber dem Niedersächsischen Landtag zur gesetzlichen Verankerung des Moorschutzzieles von jährlich 1,6 Millionen Tonnen Treibhausgas-Einsparung im Klimagesetz für das Jahr 2030 geäußert.
Klimaschutzziele müssen sektorspezifisch festgelegt werden
Die Landwirtschaft, deren Treibhausgasemissionen weit überwiegend auf natürlichen Prozessen in Böden oder bei der tierischen Verwertung von pflanzlichen Rohstoffen beruhen, die für die menschliche Ernährung nicht geeignet sind wie zum Beispiel der Grasaufwuchs von Grünland, darf beim Klimaschutz nicht mit Sektoren verglichen werden, deren Emissionen nahezu ausschließlich durch die Verwendung fossiler Rohstoffe zum Beispiel für den notwendigen Energiebedarf entstehen. Hier wird es vielleicht technisch in kurzer Zeit möglich sein, diese Emissionen vollständig zu vermeiden und damit die Treibhausgasneutralität grundsätzlich zu erreichen. Für die Durchsetzbarkeit dieser Transformation wäre dann allein die Frage der Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend.
Als Reaktion auf die geplanten Verschärfungen des Niedersächsischen Klimagesetzes hat der Landesverband aber die Landtagsabgeordneten sehr eindringlich darauf hinweisen müssen, dass in der Primärproduktion der Nahrungsmittelerzeugung, aber auch bei nachwachsenden Rohstoffen aus biologischen Gründen eine vollständige Vermeidung von Emissionen nicht möglich ist.
Das Landvolk warnt hier vor einer Politik, die eine intensive, aber klimaeffiziente Erzeugung der Landwirtschaft für ein regionales Ziel aufopfert und durch Verlagerung der Erzeugung in weniger effiziente Strukturen und Regionen dem Klimaschutz einen Bärendienst erweist. In Niedersachsen sind damit zehntausende von Arbeitsplätzen und Milliarden an Wertschöpfung in der Landwirtschaft und ihrem vor- und nachgelagerten Bereich gefährdet.
Gleichwohl verschließt sich der Verband nicht dem unumstritten notwendigen Abbau an Treibhausgasemissionen auch in der niedersächsischen Landwirtschaft und sieht hier das im Bundesklimaschutzgesetz 2021 festgelegte Sektorziel für 2030 als sehr ambitioniert, aber mit entsprechenden Rahmenbedingungen auch erreichbar an. Darauf sollte die Landespolitik sich jetzt einigen und damit Planungssicherheit, statt noch größere Verunsicherung über die Zukunft auf den Höfen und den Familien im ländlichen Raum zu schaffen als sie ohnehin besteht.
Artikel von

Hartmut Schlepps
Umweltreferent

Dr. Nataly Jürges
Umweltreferentin
Datenschutz: Nach fünf Jahren ist die Europäische Grundverordnung immer noch eine Herausforderung
Am 23. Mai 2023 feierte die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ihren fünften Geburtstag. Seit der Einführung ergänzen neue Vorschriften auf europäischer und nationaler Ebene sowie zahlreiche EuGH-Urteile die DSGVO. In der praktischen Anwendung kann dieses zu Rechtsunsicherheiten führen und stellt eine Herausforderung für Verantwortliche dar. Hier setzt die datenschutzrechtliche Beratung der Datenschutzbeauftragten und Unterstützung bei der praxisorientierten Umsetzung an.

Maike Körlin
„Die Gefahr eines Cyberangriffs durch Schadprogramme oder ähnliches kann leider nicht auf „0“ reduziert werden. Dennoch leisten jährliche Datenschutzschulungen und zeitnahe Hinweise auf aktuelle Bedrohungslagen einen Beitrag zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines Angriffs.“
Als neuer Lösungsansatz des „Cookie-Problems“ auf Webseiten werden vermehrt sogenannte „Pur-Abo-Modelle“ angeboten. Den Nutzenden einer Website wird über ein Einwilligungsbanner zwei Wahlmöglichkeiten gegeben, um die Inhalte der Website lesen zu können. Es kann ein „Pur-Abo“ abgeschlossen werden, oder die Nutzenden willigen – ohne „Pur-Abo“ – ein, dass ihre Daten für profilbasierte und individualisierte Werbung genutzt werden dürfen.
Nur wenn das „Pur-Abo“ gewählt wird, kann die Website ohne Nachverfolgen ihres Verhaltens, individuelle Profilbildung und personalisierte Werbung genutzt werden. Die Nutzenden zahlen also dafür, dass ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung nicht durch digitales Marketing monetarisiert werden. Werden die Prüfmaßstäbe nicht eingehalten, kann dieses zu Beschwerden der betroffenen Webseitenbesucher führen.
Neue Regelungen im Beschäftigungsdatenschutz
Seit dem 1. Januar 2023 gilt die neue elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die Verantwortlichen müssen bestimmte Informationspflichten beachten und diese besondere Kategorie von Daten im Kontext einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor unbefugter und unrechtmäßiger Verarbeitung schützen. Geeignete technische Sicherungsmaßnahmen und Vorlagen zur Erfüllung der neuen Informationspflichten sorgen für den Schutz dieser sensiblen personenbezogenen Daten.
Cybercrime & Datenpannen
Mit „Warnmeldungen“ über das missbräuchliche Ausnutzen von Schwachstellen in Software, Google Ads etc. durch Cyberkriminelle und konkreten Informationen über aktuelle Phishingmails im Landvolk-Kontext werden die Vertragspartner zeitnah über aktuelle Bedrohungslagen aufgeklärt. Dennoch können sowohl neuartige Cyberangriffe als auch analoge Datenschutzverletzungen wie eine unbefugte Offenlegung von personenbezogenen Daten einen Datenschutzverstoß verursachen. Mit Hilfe der datenschutzrechtlichen Beratung und Unterstützung können Verantwortliche ihren daraus resultierenden Verpflichtungen nachkommen.
Einheitliche Datenschutzbußgelder in Europa
Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat am 24. Mai 2023 die endgültigen Leitlinien zur Bußgeldzumessung nach einer öffentlichen Konsultation angenommen. Die europäischen Aufsichtsbehörden dürfen bei Verstößen gegen die DSGVO Bußgelder erlassen. An den Kriterien hat sich nichts geändert, jedoch wird die Anwendung der gesetzlichen Vorgaben europaweit harmonisiert.
Aktualisierung und neue Projekte in den Geschäftsstellen
In der Datenschutzpraxis gilt es, bestehende Datenschutzdokumente auf Aktualität zu prüfen und an veränderte Verarbeitungen von personenbezogenen Daten anzupassen. Zudem besteht das Erfordernis als Verantwortlicher seinen Informationspflichten auch im Rahmen von neuen Projekten nachzukommen. In diesem Kontext stehen die Anpassungen und Entwicklung von Datenschutzerklärungen wie zum Beispiel für die „Tour de Flur“ oder den Berufswettbewerb.
Neue Auftragsverarbeiter mit Zugriff auf personenbezogene Daten werden vor Beauftragung auf Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen geprüft. Sowohl die Prüfung als auch die spätere Beauftragung mit dem Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages ist regelmäßig Gegenstand der Beratung. Die Aufsichtsbehörden stellen hohe Anforderungen an die datenschutzrechtliche Ausgestaltung dieser Verträge. Im Kontext einer Datenschutzverletzung muss der Verantwortliche (Auftraggeber) einen schriftlichen Auftragsverarbeitungsvertrag nachweisen.
Fazit
Neue gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene sowie nationale Gesetze erfordern eine ständige Prüfung und Anpassung der datenschutzrechtlichen Prozesse in der Praxis. Mit entsprechender Beratung und Vorlagen lassen sich diese Herausforderungen stemmen. Durch die Künstliche Intelligenz (KI) in der Textverarbeitung gelingt es Cyberkriminellen, sprachlich und inhaltlich perfekte Texte für Phishingmails oder gefälschte Webseiten zu formulieren. Die Gefahr eines Cyberangriffs durch Schadprogramme oder ähnliches kann leider nicht auf „0“ reduziert werden. Dennoch leisten jährliche Datenschutzschulungen und zeitnahe Hinweise auf aktuelle Bedrohungslagen einen Beitrag zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines Angriffs.


Artikel von
Maike Körlin
Referentin für Datenschutz der Kreisverbände
- Rechtsdienstleistung ist Privileg berufsständischer Organisationen
- Niedersachsen im Fokus von Höchstspannungsstromleitungs- und Gasfernleitungs- Infrastrukturvorhaben
- Düngerecht: Befreiungsschlag lässt auf sich warten
- Klimaschutz im Moorland Niedersachsen- Too big to fail?
- Datenschutz: Nach fünf Jahren ist die Europäische Grundverordnung immer noch eine Herausforderung