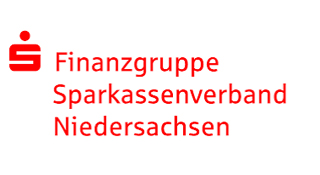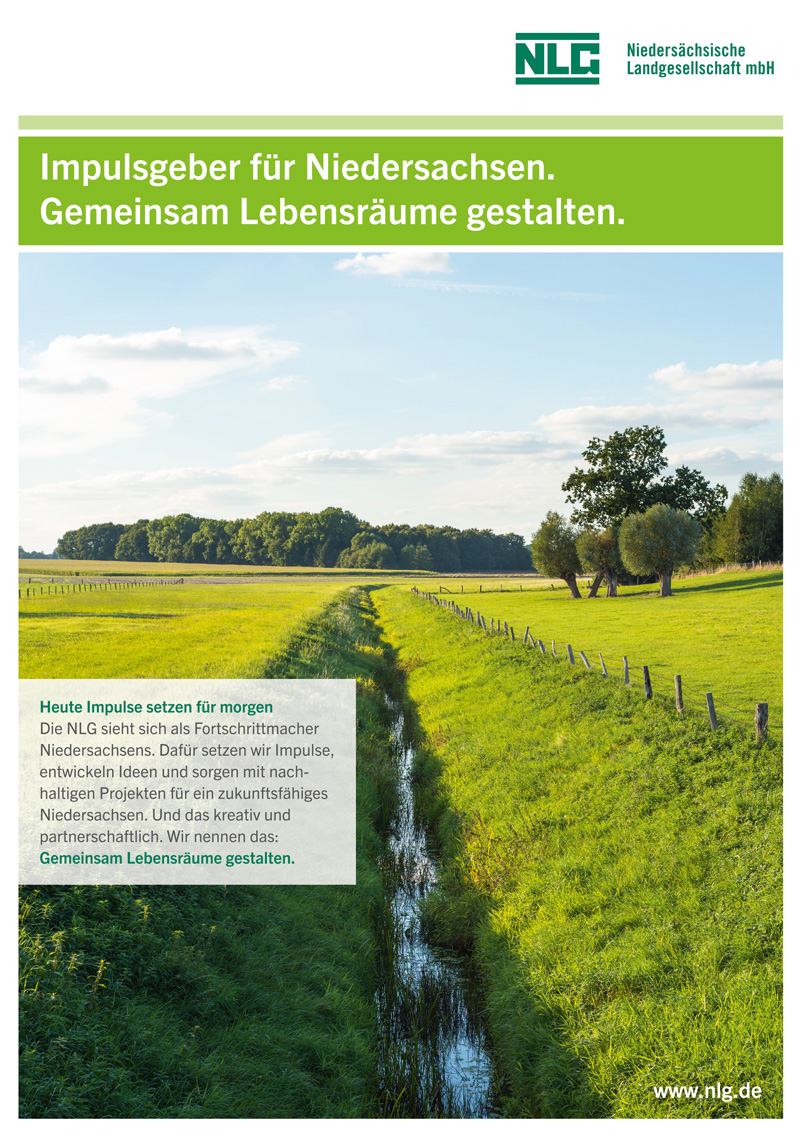Agrarmarktpolitik
Klima, Tierwohl und Marktpolitik – Themenvielfalt im Milchausschuss
Während die Milcherzeuger im vergangenen Jahr bei historischen Höchstauszahlungspreisen noch über die Möglichkeiten des Tierwohlmonitorings und die Erfassung des CO2-Fußabdrucks der Milch diskutierten, wendete sich das Blatt in den ersten Monaten des Jahres 2023. Der Milchmarkt und die Produktionskosten rückten erneut in den Fokus.
Manfred Tannen
„Wir vom Landesbauernverband sind intensiv mit den Förderinstrumenten der Gemeinsamen Agrarpolitik beschäftigt und versuchen dort günstige Rahmenbedingungen für nötige Zukunftsinvestitionen nicht nur fürs Tierwohl zu bekommen. Die Zukunftschancen unseres Berufsnachwuchses haben im Milchausschuss höchste Priorität.“
Die niedersächsische Milchwirtschaft im Jahr 2022/23 war geprägt von Extremen. Die zweite Jahreshälfte 2022 brach alle Rekorde und erreichte Spitzenauszahlungspreise von über 60 Cent/kg. Ab Jahresbeginn 2023 fiel der Milchpreis stark ab und sank bis Juni 2023 im Schnitt um 16,6 Cent/kg Milchgeld ab.
Milcherzeugerpreise fallen nach historischen Höchstwerten
Eine gute Binnenmarktnachfrage und der gestiegene Export bei knappen Milchmengen sorgten dafür, dass die Erzeugerpreise für Milch stark anstiegen. Niedersächsische Milcherzeuger erzielten im Jahr 2022 im Durchschnitt einen Erzeugerpreis von 54,86 Cent/kg, was einem Anstieg von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Ende des 3. Quartals 2022 zeichnete sich bereits der anstehende Abwärtstrend ab. Die steigende Inflation führte zu Absatzverlusten im Export, während die Verbraucherpreise im Lebensmittelbereich deutlich stiegen. Die Preise für Milch- und Molkereiprodukte im deutschen Einzelhandel erhöhten sich, was zu einer Verringerung der Nachfrage führte, insbesondere bei Markenherstellern und Premiumsegmenten wie „Bio“. Der Export in Drittländer geriet ebenfalls ins Stocken. Dementsprechend mussten Milcherzeuger mit dem Jahreswechsel 2023 Erzeugerpreisrücknahmen hinnehmen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 hofft die Branche auf eine Belebung der Nachfrage durch die sinkende Verbraucherpreise und eine Erholung im Export.
Angesichts dieser volatilen Marktlage stand das Landvolk Niedersachsen im intensiven Austausch mit der Politik, um sich insbesondere für die Planungssicherheit und Zukunftssicherung der niedersächsischen Milchviehbetriebe einzusetzen. Im Vordergrund standen dabei verlässliche Förderungen für Grünland im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), klare Vorgaben im Bereich Stallbau hinsichtlich des Umwelt- und Tierschutzes, sowie die Vertragstreue zwischen Verarbeitern und Abnehmern von Molkereiprodukten und die Beibehaltung der Lieferantenbeziehungen zwischen Molkerei und Milcherzeuger.
Niedersachsens Milcherzeuger als Vorreiter in Sachen Tierwohl – Entlohnung nicht gesichert
Nach der Etablierung des QM++-Labels und der Anerkennung des ProWeideland-Labels für die Stufe 3 der wirtschaftsgetragenen Haltungsformkennzeichnung im Jahr 2022 konnten in diesem Jahr einige niedersächsische Molkereien mit der Vermarkung von Tierwohlmilch starten. Insbesondere die Weidehalter aus Niedersachsen und die Landwirte mit neueren Stallanlagen konnten, sofern die Molkereien an entsprechenden Programmen partizipierten, ihre Milch aus höheren Haltungsformstufen veräußern. Die in Niedersachsen großflächig vorherrschenden modernen tierwohlkonformen Ställe ermöglichen ein großes Angebot an Tierwohlmilch. Während der Konsum von konventioneller und Bio-Trinkmilch in diesem Jahr geringer ist als im Vorjahr, wurde bei der Weidemilch ein starker Absatzzuwachs verzeichnet. Dennoch handelt es sich hierbei weiterhin um geringere Mengen der Konsummilch, die etwa zehn Prozent des Absatzes ausmacht.
Käse, Joghurt und weitere Produkte werden bislang nicht gekennzeichnet oder vergütet, während die Produktionskosten auf einem hohen Niveau verbleiben. Die Diskrepanzen zwischen den Anforderungen des Handels und der Entlohnung der inländischen Produktion stellen sich als Kernproblem der hiesigen Landwirtschaft heraus. Der Lebensmitteleinzelhandel verstärkt mit Einzelaktionen, wie zum Beispiel der Ankündigung eines Haltungswechsels, den Druck auf die Erzeuger, obwohl diese sich im gegebenen Rechtsrahmen bewegen. In Gesprächen setzte sich das Landvolk Niedersachsen fortwährend für mehr finanzielle Sicherheit bei der Einführung weiterer, erhöhter Produktionsstandards ein.
Klimaschutz als neue Herausforderung
Die Landwirtschaft ist besonders betroffen von der Klimakrise. Die Bilanzierung der Treibhausgase in der Milchviehhaltung, der hohe Methanausstoß bei der Verdauung der Kühe und die Wiedervernässung von Moorböden sind Beispiele für die klimarelevanten Themen, mit denen sich die Mitglieder des Milchausschusses in diesem Jahr befasst haben.
Die Klimabilanzierung ermöglicht es, die Emissionsquellen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu ergreifen. Dies ist entscheidend, um die Milchwirtschaft langfristig umweltfreundlicher zu gestalten und den Klimawandel einzudämmen. Ein Großteil der niedersächsischen Milchviehbetriebe ist bereits bilanziert, wodurch belegt werden konnte, dass Norddeutschland weltweit mit zu den klimaeffizientesten Standorten der Milchproduktion gilt. Das Landvolk Niedersachsen hebt dies regelmäßig in Diskussionen hervor und beteiligt sich aktiv an der Gestaltung der Klimabilanzierung, sowie an der Gestaltung der Beratung der Betriebe hinzu einem klimafreundlicheren, als auch einem klimaresilienteren Wirtschaften.


Artikel von
Nora Lahmann
Referentin für Milch
Tierhaltungskennzeichnung und Tierwohl bleiben Stückwerk
Im Tierhaltungskennzeichnungsgesetz fehlt noch die Verarbeitungsware und der Bereich Sauenhaltung. Damit fehlt den Sauenhaltern noch eine wichtige Grundlage zur Erarbeitung eines Betriebs- und Umbaukonzeptes für das Deckzentrum!
Enno Garbade
„Im Februar 2024 müssen alle Sauenhalter melden, wie sie ihr Deckzentrum umbauen wollen. Falls sie das nicht können, müssen sie spätestens 2029 ihre Sauenhaltung schließen. Im Arbeitskreis wollen wir vor allem die aktiv wirtschaftenden Landwirte stärken, für die die aufgeben müssen, konnten wir die Umstrukturierungsprämie erreichen.“
Im Koalitionsvertrag der „Ampel“ von 2021 wurde der artgerechte Umbau der Tierhaltung als vorrangiges Ziel festgehalten und die Einführung einer verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung geplant. Ursprünglich orientierten sich die Pläne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) an der Eierkennzeichnung. Vorgesehen war allerdings nur eine einzige Haltungsstufe für geschlossene Ställe, während höhere Stufen einen Offenfrontstall oder Auslauf erforderten. Der Berufsstand drängte daher auf eine weitere Stufe für geschlossene Ställe mit erweiterten Kriterien, um die etablierte Initiative Tierwohl fortführen zu können. Schließlich wurde dieser Forderung nachgegeben und im Gesetzentwurf eine zweite Stufe für geschlossene Ställe eingeführt.
Das „Gesetz zur Erleichterung der baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen an die Anforderungen des Tierhaltungskennzeichnungsgesetz “ wurde auch intensiv vom Verband begleitet und im Juni 2023 im Bundestag verabschiedet. Nun sind weitere Erleichterungen dringend notwendig, da die aktuellen Regelungen keine geeigneten Perspektiven und Planungssicherheit für einen umfassenden Umbau der Tierhaltung bieten. Stattdessen scheinen sie auf Nischenprogramme abzuzielen. Für das vom BMEL vorgesehene Förderprogramm liegen bis dato nur die Richtlinien-Entwürfe vor. Mit der Begrenzung der Förderung auf 200 Sauen dürfte dieses Programm in der Sauenhaltung ebenfalls lediglich Nischenbetriebe bedienen.
Das Landvolk Niedersachsen hat wiederholt den starken Strukturwandel in der Schweinehaltung kritisiert. Der Schweinebestand in Niedersachsen ist im Zeitraum 2010 bis 2023 um 15 % zurückgegangen und liegt aktuell mittlerweile unter sieben Millionen. Die Zahl der Schweinehalter hat sich im gleichen Zeitraum mehr als halbiert (Rückgang um 54 %). Noch gravierender ist der Einbruch in der Sauenhaltung. Die Anzahl der Sauenhalter hat sich in Niedersachsen seit 2010 um 70 % vermindert und die Anzahl der Sauen um 35 %. Dabei handelte es sich nicht um einen kontinuierlichen Rückgang, sondern um einen beschleunigten Absturz des Sauen- und Schweinebestandes seit 2020.
Um dem entgegenzuwirken, fordert das Landvolk Niedersachsen nach wie vor eine staatliche Herkunftskennzeichnung für Fleisch und Verarbeitungsprodukte. Zwar hat das Bundeskabinett am 26. Juli 2023 einen Verordnungsentwurf des BMEL gebilligt, nach dem künftig unverpacktes Fleisch auch von Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel eine Herkunftskennzeichnung aufweisen muss. Dies gilt für jedes frische, gekühlte oder gefrorene Stück Fleisch dieser Tierarten. Bisher war es nur bei vorverpacktem Fleisch vorgeschrieben. Diese Verordnung geht zwar in die richtige Richtung, bleibt aber Stückwerk, weil unter anderem der Geburtsort, Verarbeitungsprodukte und Gastronomie noch nicht eingebunden sind.


Artikel von
Markus Kappmeyer
Referent für Vieh und Fleisch
Vieh und Fleisch: Aussichten der Tierhalter bleiben vorerst unsicher
Insgesamt gesehen befindet sich die Tierhaltung in einem Transformationsprozess zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und höheren Anforderungen in den Bereichen Tierwohl, Tiergesundheit und Verbraucherschutz. Vieles ist noch vage und wird noch im politischen Bereich diskutiert. Das verunsichert die Tierhalter, und es werden viele notwendigen Investitionen aufgeschoben oder gar nicht mehr geplant. Vor diesem Hintergrund tun sich viele Sauenhalter schwer, bis Februar 2024 ein Umbaukonzept für das Deckzentrum gemäß der Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung vorzulegen.
Martin Lüking
„Die Rindermastbetriebe entwickeln sich im Rahmen der Initiative Tierwohl weiter, leider ist die Nachfrage überhaupt nicht vorhanden. Das stellt das Grundproblem dar: Die Angebotsseite wird hochgepusht, und der Verbraucher entscheidet sich an der Kasse anders, als er vorher sagt.“
Jörn Ehlers
„Die Tierhaltung in Niedersachsen ist wichtig, und so muss es auch bleiben. Im Veredelungsausschuss haben wir uns intensiv mit den Themen Tierwohl und Tierschutz auseinandergesetzt. Dabei war es uns wichtig, dass wir diese Dinge auch in die Wertschöpfung hineinbringen, um die Schweinehaltung in Niedersachsen weiter aufrecht erhalten zu können.“
Veränderungen bei ITW Schwein
Die Initiative Tierwohl (ITW) hat zur Jahresmitte konkretisiert, wie es ab Januar 2024 weitergeht: Für Schweinehalter gilt künftig die Empfehlung eines Preisaufschlags von 5,28 Euro. Alle Schweinemäster sollten daher rechtzeitig Vereinbarungen mit ihren Abnehmern treffen, in denen der entsprechende Tierwohlaufpreis festgehalten wird. Davon ausgenommen sind die Ferkelerzeuger, die weiterhin ein festes Tierwohlentgelt aus dem Ferkelfonds erhalten. Um die Nämlichkeit für Schweinefleisch stärker zu fördern, wird ab dem 1. Juli 2024 ein Bonus-System für die Vermarktung von nämlichen Ferkeln eingeführt. Ferkelaufzüchter, die an ITW-Mäster liefern, erhalten mit vier Euro pro Tier ein höheres Entgelt pro abgegebenem Ferkel. Ferkelerzeuger, die seit Beginn der dritten Programmphase an der ITW teilnehmen – sogenannte Bestands-Ferkelaufzüchter, erhalten auch weiterhin ein Entgelt für alle aufgezogenen Ferkel. Das Entgelt für Ferkel, die an einen Nicht-ITW-Mäster geliefert werden, beträgt drei Euro pro Tier.
Mit Blick auf die staatliche Tierhaltungskennzeichnung sowie auf mögliche Änderungen in der Tierschutz-Nutztierverordnung wird es voraussichtlich zum Jahr 2025 weitere Veränderungen bei den Anforderungen geben. Ferner ändert sich die Prüfsystematik. Die jährlichen Programmaudits sowie ein unangekündigter Bestandscheck ersetzen in Zukunft die Bestätigungsaudits. Diese Änderungen gehen einher mit einer Umstellung der Teilnahmelaufzeiten. Es gibt keine zeitliche Begrenzung der Teilnahmedauer mehr. Die Teilnahme verlängert sich automatisch, sofern diese nicht gekündigt und alle Audits bestanden werden. Seit September 2023 können sich alle Schweinehalter für das Programm 2024 registrieren.
Bei Meldungen und Datenbanken muss Bürokratie abgebaut werden
In 2023 gab es aufgrund von Änderungen im Arzneimittelrecht Erweiterungen hinsichtlich der taggenauen Meldeverpflichtungen für die Tierhalter. Für die Schweinehalter kam außerdem die Pflicht zur Abgabe der Abgangsmeldungen an die HI-Datenbank aufgrund Änderungen im EU-Tiergesundheitsrecht hinzu, die von den Ländern ab 1. August 2023 verlangt wurde.
Ein besonderes Ärgernis ist es, dass die Landwirte viele Meldungen teilweise parallel, teilweise zu unterschiedlichen Stichtagen, an verschiedene Datenbanken und Register zu melden haben. Warum diese staatlichen Datenbank und Register voneinander getrennt – teilweise dieselben – Daten erheben und verwalten, ist im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr zu verstehen. Dort muss Bürokratie abgebaut werden!
Rindermastbetriebe warten immer noch auf die Etablierung des ITW-Rindfleisches
Die Rindfleischerzeugerpreise entwickelten sich seit 2022 positiv, aber die starken Schwankungen von Rekordpreisen bei Jungbullen (R3) bis zu sechs Euro/kg Schlachtgewicht (SG) und anschließenden Korrekturen bis auf 4,40 Euro/kg SG verdeutlichten die Preissensibilität der Verbraucher. Diese Sensibilität besteht weiterhin und sollte von der Politik bei möglichen höheren Standards in der Erzeugung berücksichtigt werden. Geopolitische Ereignisse hatten Auswirkungen auf der Erzeugerseite, da die Kosten für wichtige Betriebsmittel wie Energie und Futter deutlich anstiegen. Das Landvolk Niedersachsen betonte die Notwendigkeit praxistauglicher Umsetzungen bei gesetzlichen Verschärfungen und höheren Tierwohlstandards. Kritik äußerte das Landvolk bezüglich der Überlegungen der EU, die Rinderhaltung in die Industrieemissionsrichtlinie einzubeziehen, da dadurch enormer bürokratischer Aufwand und zusätzliche Kosten für Tierhalter entstehen könnten.
Die Rindermastbetriebe, die der ITW-Rind beigetreten sind, warten immer noch auf die Etablierung des ITW-Rindfleisches (Haltungsform Stufe 2) im Lebensmitteleinzelhandel. Die Abnehmer sind bisher nur im geringen Maße bereit, längerfristige Verträge mit kostendeckenden Zuschlägen für diese Tiere zu zahlen.
Deutschland ist weltweit Vorreiter beim Verzicht auf Kükentöten
Ende 2022 veröffentlichte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die „Eckpunkte für Mindestanforderungen an die Haltung von Mastputen“. Dies führte zu massiver Kritik seitens des Deutschen Bauernverbandes (DBV) und anderer Branchenverbände. Das BMEL bewertet die bisherigen freiwilligen Eckwerte der Putenwirtschaft, zuletzt 2013 angepasst, jedoch als unzureichend. Die Ampelparteien haben daher in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Lücken in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung zu schließen. Die EU plant zudem eine Neufassung des Tierschutzrechts. Es ist derzeit unklar, wann harmonisierte EU-Vorgaben für Mastputen zu erwarten sind.
Seit dem 1. Januar 2022 ist das Töten von Küken gesetzlich verboten, womit Deutschland weltweit Vorreiter ist. Ursprünglich war geplant, ab dem 1. Januar 2024 auch das Töten von Embryonen im Ei nach dem 6. Bebrütungstag im Zusammenhang mit der Geschlechtsbestimmung zu untersagen. Jedoch hat ein Bericht, den das BMEL in Auftrag gegeben hat, ergeben, dass bis Ende 2023 kein marktfähiges Verfahren zur Geschlechtsbestimmung bis zum 6. Tag verfügbar sein wird. Die Studie zeigt auch, dass das Schmerzempfinden von Hühnerembryonen erst ab dem 13. Bebrütungstag einsetzt – sieben Tage später als angenommen.
Das Landvolk Niedersachsen hat den Gesetzgeber aufgefordert, darauf zu reagieren, um Rechtssicherheit für die Betriebe zu schaffen. Die Bundesregierung hat daraufhin Anfang Mai eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag beschlossen, wonach das Verbot stattdessen ab dem 13. Bebrütungstag wirksam werden soll.
Tierschutzplan Niedersachsen endet – Umstrukturierungsprämie kommt
Mit der Sitzung des Lenkungsausschusses am 7. August 2023 endete die Niedersächsische Nutztierstrategie – Tierschutzplan 4.0. Nach Aussage des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums (ML) wird es ein ähnliches Anschlussformat geben, wobei jedoch Änderungen durch Streichung und Neubildung von Gremien geplant sind.
Seit 2017 fordern das Landvolk Niedersachsen und die Gremien des Tierschutzplans im Rahmen der Mastrinder-Leitlinie ein Förderprogramm für bestehende Ställe. Aktuelle Fördermöglichkeiten haben sich als nicht praxistauglich erwiesen. Der Berufsstand fordert zudem von der neuen Landesregierung, dass endlich ein Förderprogramm zur Umsetzung der Mastrinder-Leitlinie aufgelegt wird. In Niedersachsen erhalten im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen Kälbermast- und Fresseraufzuchtbetriebe weiterhin keine Förderung für den Einbau weicher Liegeflächen, wie sie aufgrund der Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in 2020 gefordert werden. Auch dort ist die Landesregierung aufgefordert, mit Nordrhein-Westfalen gleich zu ziehen.
Das Landvolk fordert seit Oktober 2021 im Zusammenhang mit der Nutztierstrategie des „Borchert-Plans“ eine Umstrukturierungsprämie für jene Schweinehalter, die in ihren Betrieben die Transformation der Tierhaltung aus bestimmten Gründen wie Flächenknappheit, mangelndem Kapital oder ungünstigem Betriebsstandort, nicht bewerkstelligen können. Dazu gab es seitdem im niedersächsischen Landtag mehrere Anhörungen. Die Regierungskoalition hat die Thematik inzwischen aufgegriffen und 2023 dem Landtag Eckpunkte für eine „Diversifizierungsprämie“ vorgelegt. Der Landtag hat diese dann beschlossen.


Artikel von
Markus Kappmeyer
Referent für Vieh und Fleisch
Veterinärwesen: Aufarbeitung der ASP-Krise im Emsland läuft
Ein Jahr nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem niedersächsischen Schweinehaltungsbetrieb im Landkreis Emsland ist die Aufarbeitung der Krise in vollem Gange. Das Landvolk Niedersachen appelliert an die Politik, die Dauer der ASP-Sperrzonen deutlich zu verkürzen und Restriktionsradien zu minimieren. Außerdem muss es staatliche Entschädigungen für alle betroffenen Landwirte geben.

Dr. med. vet. Wiebke Scheer
„Alle Wirtschaftsbeteiligten – vom Schlachthof bis zum Lebensmitteleinzelhandel – müssen sich zu ihrer gemeinsamen Verantwortung bekennen, makellose Erzeugnisse auch im Seuchenfall abzunehmen.“
Georg Meiners
„Durch die Restriktionszonen während des ASP-Ausbruchs ist ein hoher wirtschaftlicher Schaden in Höhe von etwa 10 Millionen Euro entstanden. Vor allem, weil das gesunde Fleisch nicht normal vermarktet werden durfte.“
Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Niedersachsen im Jahr 2022 zeigte auf, welche (teils unerwarteten) Probleme entstehen, wenn sich Schlachttiere aus Restriktionsgebieten nicht vermarkten lassen: Wie zuvor in Übungsszenarien der Arbeitsgemeinschaft „Krisenpläne der Wirtschaft“ gezeigt, kommt die gesamte Produktionskette zum Erliegen.
Die betroffenen Landwirte in den Sperrzonen unterlagen unverschuldet behördlich angeordneten Maßnahmen, die erhebliche Vermarktungsschwierigkeiten für Schweine und Schäden in zweistelliger Millionenhöhe mit sich brachten. Schuld daran ist die bis dato geltende EU-Rechtslage sowie die geringe Kooperationsbereitschaft in Teilen der Schlacht- und Verarbeitungsbranche und dem Lebensmitteleinzelhandel.
Einzelne Betriebe in den Restriktionsgebieten gaben auf, weil ihnen keine Entschädigungszahlungen zustanden, da sie nicht direkt von der ASP betroffen waren. Vor diesem Hintergrund setzt sich das Landvolk Niedersachsen bis heute für eine deutliche Verkürzung der Dauer der Sperrzonen (Ziel: 30 Tage) und auch für eine Minimierung der Restriktionsradien ein. Doch zur Änderung der Rechtslage ist auf Europäischer Ebene ein dickes Brett zu bohren. Ein staatliches Ankaufsprogramm und die Entschädigung der betroffenen Tierhalter sind weitere Forderungen des Verbandes, um Betriebsaufgaben beim nächsten Ausbruch der Seuche zu vermeiden. Unter den aktuellen Bedingungen ist die nächste Krise sicher, und finanzielle Einbußen können nur durch Ertragsschaden-Versicherungen abgemildert werden.
Trotz guter Zusammenarbeit mit den Landes- und kommunalen Veterinärbehörden ist die Situation bis heute nicht zufriedenstellend. Die Tierhalter brauchen dringend die Unterstützung durch die Politik. Auf Drängen des Landvolks wurde im Juni 2023 endlich eine „Arbeitsgruppe zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der ASP“ unter der Leitung des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums einberufen, die für den nächsten Krisenfall in verschiedenen Unterarbeitsgruppen Abhilfe schaffen soll. Das Landvolk wirkt in allen Arbeitsgruppen aktiv mit, macht seine Forderungen vehement deutlich und setzt sich für die Landwirte ein. Alle Wirtschaftsbeteiligten – vom Schlachthof bis zum Lebensmitteleinzelhandel – müssen sich zu ihrer gemeinsamen Verantwortung bekennen, makellose Erzeugnisse auch im Seuchenfall abzunehmen.
Biosicherheit: Landvolk kommt vor die Welle
Nicht nur die ASP, sondern auch die Geflügelpest dominierten in Niedersachsen das Seuchengeschehen und verursachten hohe Bekämpfungskosten. Um die Prävention zu stärken und um den Anforderungen des neuen Tiergesundheitsrechts der Europäischen Union (EU) gerecht zu werden, wurden auf Initiative der Niedersächsischen Tierseuchenkasse und des Landvolks zwei Arbeitsgruppen (AG) mit maßgeblichen Akteuren gegründet. In den „AGs Biosicherheit in Schweine- und Geflügelhaltungen“ wurden Arbeitshilfen für Tierhalter, Tierärzte und Behörden geschaffen, die das anzuwendende EU- und nationale Recht in Form eines betriebsindividuellen Biosicherheitskonzeptes abbilden.
Das effektivste Mittel gegen den Eintrag von Tierseuchenerregern in Tierhaltungen ist die Abschirmung des Tierbestandes durch wirksame Biosicherheitsmaßnahmen. Daher sind alle Nutztierhalter grundsätzlich dazu aufgefordert, diese zu optimieren und strikt einzuhalten, um so eine Verschleppung der Infektionserreger zu unterbinden.
Durch das neue Tiergesundheitsrecht der Europäischen Union (EU) stehen Tierhalter, aber auch Tierärzte in der besonderen Verantwortung, den „Schutz vor biologischen Gefahren“ sicherzustellen. Diese Anforderungen nach EU-Recht implizieren ein betriebsindividuelles Biosicherheitskonzept, in dem die verantwortlichen Nutztierhalter Maßnahmen schriftlich fixieren müssen, um den Eintrag von Tierseuchenerregern zu verhindern. In den Aufgabenbereich der Tierärzteschaft fallen insbesondere Beratungen des Tierhalters zum Schutz vor biologischen Gefahren und anderen Tiergesundheitsaspekten, die im Rahmen von Tiergesundheitsbesuchen erfolgen sollen.
Die Biosicherheitsanforderungen des EU-Rechts betreffen alle Nutztierhalter. Vor diesem Hintergrund wurde unter Leitung der Niedersächsischen Tierseuchenkasse und des Landvolks bereits im vergangenen Jahr das Niedersächsische Biosicherheitskonzept für Schweine haltende Betriebe im Rahmen einer Arbeitsgruppe (AG) mit maßgeblichen Akteuren aus 21 Institutionen erarbeitet: https://landvolk.net/ und https://www.ndstsk.de/.
Ende Februar dieses Jahres wurde nun unter derselben Leitung die neue „AG Biosicherheit in Geflügelhaltungen“ gegründet. Ziel war es, zeitnah ein analoges Biosicherheitskonzept für Geflügel haltende Betriebe zu erarbeiten, denn im Seuchenfall sind die Leistungen der Tierseuchenkasse und der EU abhängig von der Einhaltung rechtlicher Vorgaben. Der Teilnehmerkreis der neuen niedersächsischen AG setzt sich aus Vertretern des Landwirtschaftsministeriums, der Landkreise, des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, der Universität Vechta, der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der Landwirtschaftskammer, der Tierärztekammer, des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte, der Tierseuchenkasse, des Landvolks, der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, der ABICS GmbH, des Landkreistages sowie des QS-Prüfsystems zusammen. Das nächste gemeinsame Projekt von Niedersächsischer Tierseuchenkasse und Landvolk ist die Ergänzung des Niedersächsischen Biosicherheitsleitfadens in Rinder haltenden Beständen um die Anforderungen aus dem neuen EU-Recht.
Mit dem Niedersächsischen Biosicherheitskonzept ist es den Arbeitsgruppen gelungen, geltendes EU-Recht abzubilden und den Tierhaltern betriebsindividuell ein Maßnahmenkonzept an die Hand zu geben, um sich gegen Seucheneinträge bestmöglich zu schützen. Um das Konzept und dessen Umsetzung in den Betrieben zu verankern, sollen zukünftig im Idealfall die Biosicherheitsberatungen von Tierärzten zusammen mit geschulten landwirtschaftlichen Fachberatern durchgeführt werden. Die Einbeziehung der Fachberater hilft dem Tierhalter beim Erarbeiten der notwendigen Lösungsansätze und verhindert gleichzeitig, dass unterschiedliche Sichtweisen auf Biosicherheit und damit einhergehende unterschiedliche Lösungsansätze ein Vorankommen verzögern. Von der Niedersächsischen Tierseuchenkasse werden für qualifizierte Tierärzte/Fachberater Beihilfen gewährt, sofern die Teilnahme an einer eintägigen Fortbildungsveranstaltung zum Niedersächsischen Biosicherheitskonzept nachgewiesen werden kann.


Artikel von
Dr. med. vet. Wiebke Scheer
Referentin für Veterinärwesen
Pflanzenbau: Zwischen überzogenen EU-Vorgaben, unsicheren Märkten und Trockenperioden
Dieses Jahr war geprägt von andauernden Diskussionen über den überzogenen EU-Gesetzesentwurf zur „Sustainable Use Regulation“ (SUR). Allerdings wurde mit dem Vorschlag zur Regulierung neuer Züchtungsmethoden auch ein produktiver Ansatz für zukünftige Aufgaben geliefert. Die Märkte wurden unterdessen weiterhin durch den russischen Angriffskrieg durcheinandergewirbelt. Regional machte eine Trockenperiode in der Vegetationsphase den Pflanzen erneut zu schaffen. Bei der Getreiderundfahrt im Weserbergland diskutierten Ackerbauexperten Lösungsansätze und gaben erste Ausblicke auf die Ernte 2023.
Karl-Friedrich Meyer
„Die in der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung geplante Reduzierung macht uns große Sorgen. Wir müssen eine Lösung finden, die weniger Pflanzenschutzmittel möglich macht und trotzdem unsere Erträge und unsere Nahrungsmittelproduktion in Deutschland sichert.“
Seit der Veröffentlichung im Juni 2022 kritisierten Landvolk Niedersachsen und Deutscher Bauernverband (DBV) die im Entwurf der EU zur „Sustainable Use Regulation“ (SUR) enthaltenen Gebietskulissen mit Komplettverboten und Reduktionszielen mit pauschalen Mengenvorgaben. Den Informationskampagnen des Verbandes folgend, gingen bei der anschließenden Konsultation mehr als 6.600 Beiträge ein. Allein knapp 5.700 Beiträge kamen aus Deutschland, von denen wiederum ein Großteil aus Niedersachsen stammte. Folgerichtig bremste der Rat das weitere Verfahren.
Landvolk findet in Brüssel Gehör
Anfang Mai 2023 zeigte dann eine vom DBV beauftragte Studie eindrucksvoll, dass der Gesetzesentwurf eine massive Zäsur in der Landwirtschaft bedeuten und den Anbau wichtiger Kulturen in betroffenen Kulissen unwirtschaftlich machen würde. Spätestens an dem vom Landesverband organisierten Parlamentarischen Abend Ende Mai in Brüssel überzeugte sich auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir davon, sich gegen den Erlass von Verbotskulissen einzusetzen. Mit dem Niedersächsischen Weg liegt bis heute ein Konzept vor, das aus dem Dialog mit dem Berufsstand entstanden ist und ambitionierte, aber realistische Ansprüche stellt. Diese Vorlage sollte auch in Brüssel Gehör finden.
Eine sinnvolle Alternative zu pauschalen Anwendungsverboten wurde erkennbar, als zu Beginn des Jahres eine mögliche Neuregulierung neuer genomischer Züchtungstechniken (NGT) zur Sprache kam. Eine Position war im Landesverband schnell verfasst und durch den Vorstand bestätigt. Im Schulterschluss mit dem DBV stand eine Befürwortung der Zulassung im Vordergrund. Neue innovative und stressresistente Sorten, die weniger Pflanzenschutz benötigen, könnten so schneller erzeugt werden. Allerdings ist die Position unmissverständlich an das Sortenschutzrecht und die Wahlfreiheit geknüpft.
Der schließlich am 5. Juli 2023 von der Kommission vorgestellte Gesetzesentwurf deckte bereits im Wesentlichen unsere Forderungen ab. So sollen NGT grundsätzlich zugelassen, nationale Alleingänge unterbunden, der Ökolandbau von der Regelung ausgeschlossen und die Wahlfreiheit gewährleistet sein. Kurz nach der Veröffentlichung bestätigte Özdemir die Arbeit des Berufsstandes in einer Pressemitteilung, in der er unsere Position mit der Forderung nach weiter patentfreiem Saatgut nahezu deckungsgleich als die eigene wiedergab. In diesem Punkt gilt es auch weiterhin standhaft zu bleiben. Der von EU-Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans ins Spiel gebrachte Vorschlag, die NGT als Ausgleich für die Einschnitte durch SUR hinzunehmen, soll hingegen keine Grundlage für weitere Gespräche sein.
Marktentwicklung im Zeichen des Russischen Angriffskrieges
Bei einem Blick auf den Markt standen über das ganze Jahr hinweg die Geschehnisse in der Ukraine im Vordergrund. Insgesamt ist die Entwicklung der Märkte bis heute von den Versorgungsängsten im Frühjahr 2022 geprägt, als die Erzeugerpreise im Mai/Juni in bis dato unbekannte Höhen gestiegen waren, um anschließend wieder steil zu fallen. So wurden im Vergleich zum Referenzjahr 2015 im Mai 2022 durchschnittlich 132 % höhere Preise für pflanzliche Erzeugnisse (außer Rüben) gezahlt. Im Mai 2023 waren es zum gleichen Referenzjahr 33 % mehr. Somit mussten Erzeuger ein Minus von knapp 100 % innerhalb eines Jahres verkraften. Daher kam über eine lange Zeit kaum Handel zustande. Die eine Seite wollte nicht zu günstig verkaufen, auf der anderen Seite hoffte man auf weiter sinkende Preise. Mittlerweile hat sich die Lage normalisiert und Preise sowie Handelsaktivität sind wieder auf etwa auf dem Niveau von 2021, als ein Krieg in Europa für viele noch unvorstellbar war.
Der russische Angriffskrieg wird Ende dieses Jahres bereits 22 Monate andauern. Fast zwei Jahre, geprägt von humanitärem Leid und Propaganda. Seither agieren internationale Marktteilnehmer verunsichert und Meldungen zum Getreidekorridor oder über Bombardierungen von Häfen wirbeln die Märkte regelmäßig durcheinander. Belastbare Prognosen zur Preisentwicklung gibt es kaum noch. Gleichzeitig wird viel Getreide aus der Ukraine über den Landweg Richtung Westen transportiert. Ursprünglich für den Transit gedacht, landeten große Mengen des Getreides auch an deutschen Märkten. Bundesweit waren Absatzschwierigkeiten für die heimischen Produkte die Folge. Vielerorts musste Ware mit der neuen Ernte überlagert werden. Durch Angriffe auf die zivile Infrastruktur schürte der Kreml erneut Sorgen um Versorgungsengpässe, da die Ukraine als großer Agrarexporteur somit weiter isoliert wird. Insgesamt wird sich die Lage vermutlich erst wieder normalisieren, wenn dieser Krieg endlich ein Ende findet.
Erneute Trockenperiode stört Pflanzenentwicklung im Frühling
Regional stellten Niederschlagsverteilung und Trockenheit auch in diesem Jahr viele Bäuerinnen und Bauern vor Probleme. Lediglich 42,7 mm Niederschlag wurden im Mai 2023 deutschlandweit gemessen – in Niedersachsen sogar nur 38,3 mm. So ergab sich ein Minus von etwa 20 mm Regen im Vergleich zum 30-jährigen Mittelwert (1991-2020). Der zu warme Juni konnte den Wassermangel während kritischer Wachstumsphasen nicht ausgleichen und verzeichnete außerdem mit 296,8 Sonnenstunden die höchste Sonnenscheindauer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Auch bei der diesjährigen Getreiderundfahrt wurde unter anderem die Wasserproblematik diskutiert. Der Ausschussvorsitzende, Karl-Friedrich Meyer, lud Berufskollegen, Gäste und Pressevertreter auf die Flächen seines Betriebes im Weserbergland ein, welche inzwischen von seinem Sohn bewirtschaftet werden. Gerste, Weizen und Rüben wurden inspiziert, die trotz der Trockenheit in einem respektablen Zustand waren. Zuvor wurde öffentlichkeitswirksam über aktuelle Herausforderungen am Getreidemarkt diskutiert und erste Ernteprognosen fielen trotz gemischter Einschätzungen insgesamt optimistisch aus.
Letztendlich konnte eine insgesamt unterdurchschnittliche, aber nicht sehr schwache Ernte eingefahren werden. Dabei war die Ertragsschere, regional und abhängig von der Beregnungsmöglichkeit, enorm. Die Wintergerste erreichte einen durchschnittlichen Ertrag von 80,32 dt/ha – etwas schwächer als im Vorjahr, aber immer noch um mehr als sechs dt/ha über dem Bundesdurchschnitt. Bei Weizen und Raps verzögerte sich die Ernte durch anhaltende Regenschauer im Juli und August über Wochen. Schätzungen zufolge werden die Erträge jedoch ebenfalls unterdurchschnittlich ausfallen.



Artikel von
Tom-Pascal Pielhop
Referent für pflanzliche Erzeugnisse und Ökolandbau
Ökolandbau: Hohe Ziele trotz Absatzschwierigkeiten
Für den Ökolandbau geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Der Ausschuss für Ökolandbau definierte das eigene Selbstverständnis neu und um die Ziele des Niedersächsischen Wegs gezielter zu verfolgen, wurde die Unterarbeitsgruppe Ökolandbau gegründet. Währenddessen führte die Inflation zu einer Absatzflaute, dem Abwandern von Bio-Produkten in die Discounter und einer Umstellungsmüdigkeit der Bauern.
Carsten Bauck
„Wir wünschen uns von der Politik, dass sie den Absatz stärkt und nicht so sehr die Förderung von mehr Anbau. Wenn der Absatz stimmt, können wir Bauern auch vermehrt von konventionell auf ökologisch umstellen.“
Viel Diskussionsstoff war schon im Februar geboten, als Landvolk-Präsident Dr. Holger Hennies bei der Sitzung des Ausschusses richtungsweisende Fragen stellte. Wie sich die Ertragslücke schließen lasse, ob das überhaupt nötig beziehungsweise möglich sei oder wie viel Ökolandbau Niedersachsens Märkte überhaupt tragen könnten, stellte er zur Diskussion. Fragen, mit denen sich der Ausschuss auseinandergesetzt hat und das auch weiterhin tun wird. Klar ist, dass der Ökolandbau auch im Landesverband längst einen hohen Stellenwert hat. Selbst definierte Flächenziele, Projekte wie FiNKA und die Ausschussarbeit zeigen, dass es nur mit intensivem Austausch möglich sein wird, den Anforderungen moderner Landwirtschaft gerecht zu werden.
Bio weiterhin ohne genomische Züchtung und Mineraldünger
Die Möglichkeit, Erträge im Ökolandbau zu steigern, sah der europäische Bauernverband COPA-COGECA, als im Frühjahr europaweit in den Verbänden über neue genomische Züchtungstechniken (NGT) diskutiert wurde. Sowohl im Fachausschuss des Deutschen Bauernverbandes (DBV) als auch im Landvolk Niedersachsen wurde sich daraufhin lebhaft ausgetauscht, ob genomische Züchtung oder auch „grüner“ mineralischer Stickstoffdünger zukünftig Optionen für die Bio-Landwirtschaft sein können beziehungsweise sollen.
Nach einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung stand am Ende einer langen und offenen Diskussion fest, dass der Landesverband aktuell keine Empfehlung dieser Methoden für den Ökolandbau aussprechen wird. Zu groß sind die ethischen Bedenken. Auch würde man den Prinzipien biologischer Landwirtschaft untreu werden und gegenüber Verbrauchern ein kritisches Maß an Vertrauen verlieren. Diese Position zu den neuen genomischen Züchtungstechniken wurde im Bundesausschuss und bei der COPA gehört. In dem im Juli erschienenen EU-Entwurf zur Zulassung von neuen genomischen Züchtungstechniken findet sich schließlich die Position des Ausschusses wieder. Demnach wird es auch in Zukunft keine Zulassung genomisch gezüchteter Sorten im Ökolandbau geben.
Markt bremst Flächenausbau
Ebenso klar definiert ist das Ziel des Niedersächsischen Weges und wird es auch bleiben: 15 Prozent Ökolandbau bis 2030. Dieses Ziel kann jedoch nicht losgelöst vom Markt betrachtet werden. Noch zu Corona-Zeiten erlebte eben dieser Markt große Umsatzsteigerungen. Im vergangenen Jahr wendete sich dieser Trend: Getrieben von der Inflation und dem Ende der Pandemie veränderte sich das Konsumverhalten der Verbraucher. In der Jahresbilanz war im Jahr 2022 erstmals wieder ein Ausgabenminus für Bio-Lebensmittel zu erkennen. Im Naturkosthandel und sonstigen Einkaufsstätten schlug eine Entwicklung von 12,3 Prozent, beziehungsweise 18,2 Prozent zu Buche. Ein Trend, der sich 2023 fortsetzte.
In der Direktvermarktung mussten Bio-Landwirte regional bis zu 70 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zu den starken Corona-Jahren verkraften. Immer mehr Produkte landen im Discounter und bieten so kaum Gewinnmargen. Entsprechend weniger Landwirte gab es, die auf Bio umstellten oder eine Umstellungsberatung in Anspruch nahmen.
Bezogen auf die ökologisch bewirtschaftete Fläche konnte 2020 noch ein Zuwachs um gut 14 Prozent verzeichnet werden. 2021 und 2022 steigerte sich der Flächenanteil lediglich um 3,9 Prozent, beziehungsweise 3,4 Prozent. Um unter anderem dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde in diesem Jahr unter Beteiligung des Landesverbandes mit der Unterarbeitsgruppe Ökolandbau ein Format innerhalb des Niedersächsischen Weges geschaffen, welches gezielt Projekte und Maßnahmen der Öko-Förderung in Niedersachsen begleiten und prüfen soll.
Verschiedene Ansätze wie die Öko-Modellregionen, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM), Informationskampagnen, Beratung, die Steigerung des Bioanteils in der Außer-Haus-Verpflegung, die Stärkung von Wertschöpfungsketten werden diskutiert, bewertet und hinterfragt, um den niedersächsischen Ökolandbau zu stärken. Ob die 15 Prozent ein weiter realistisches Ziel sind, scheint jedoch fraglich. Viel Arbeit wird auch in Zukunft nötig sein, um die Märkte wieder so auszurichten, dass mehr Bauern den Schritt in die ökologische Landwirtschaft wagen.



Artikel von
Tom-Pascal Pielhop
Referent für pflanzliche Erzeugnisse und Ökolandbau
Erneuerbare Energien: Verwertung von Gärresten auf landwirtschaftlichen Flächen möglich
Über das Biogasforum wurden die seit mehreren Jahren „hängenden“ Themen vorangetrieben und letztlich einer Lösung zugeführt. Zum einen ist nun abschließend die Frage geklärt, ob ein Verbringen von Gärresten auf landwirtschaftliche Flächen ein Verwerten im Sinne des § 12 Abs. 5 Düngeverordnung ist. Zum anderen ist es gelungen, einen Weg für die baurechtliche Umnutzung von bestehenden Güllebehältern für die Gärrestlagerung zu finden.
Jochen Oestmann
„Freiflächen-Photovoltaikanlagen gehören auf Flächen, die für die Landwirtschaft keine Bedeutung haben. Das ist uns als Position sehr wichtig. Die Planung jeder einzelnen Anlage muss gut abgebildet werden, damit Pachtbetriebe die Möglichkeit haben, ihre Flächen zu behalten.“
Das Verbringen von Gärresten auf landwirtschaftliche Flächen als Verwerten im Sinne des § 12 Abs. 5 Düngeverordnung wurde vom Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium im Jahr 2018 verneint, weshalb viele Biogasanlagenbetreiber, deren Anlagen nicht über Lagerkapazitäten für neun Monate verfügen, eine größere Zahl von gärrestabnehmenden Landwirten hat. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg sah das anders und die damals amtierende Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast verzichtete auf ein Rechtsmittel zum Bundesverwaltungsgericht (BVerwG).
Im Zuge des Regierungswechsels sah man im Ministerium die Gelegenheit, die Rechtsfrage nochmals durch den gerichtlichen Instanzenzug zu bringen (Begründung: Es handele sich bei dem Oberverwaltungsgericht-Urteil um eine „Einzelfallentscheidung“). Erfreulicherweise sprach Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte ein Machtwort, so dass – endlich – fünf Jahre später die Verwertung der Gärreste auch auf der landwirtschaftlichen Fläche möglich ist.
Task Force Energiewende bringt Impulse aus der Praxis in Planungs- und Genehmigungsverfahren
Um die Energiewende in Niedersachsen deutlich zu beschleunigen, ist – neben regulatorischen Lösungen – vorgesehen, die praktischen Probleme auf Ebene der Vorhabenrealisierung zu lokalisieren und zu beheben. Insbesondere sollen Planungs- und Beschleunigungsprozesse deutlich vereinfacht werden. Dem soll die Taskforce Energiewende dienen. Die Taskforce wird von Wirtschaftsminister Olaf Lies, Umweltminister Christian Meyer und Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte geleitet.
Neben einem Plenum, das zweimal tagte, und kommunalen Umsetzungsgruppen, nahmen sechs Projektgruppen unter anderem zu den Bereichen Wind, Photovoltaik und Bioenergie eine intensive Sitzungstätigkeit auf. Darin konnte sich das Landvolk Niedersachsen intensiv einbringen, insbesondere auch dank der Mithilfe der Kreislandvolkverbände. Besonders hervorzuheben sind die Verbände Diepholz und Nordostniedersachsen. Die Arbeit des Biogasforums wurde zum Teil in die Projektgruppe Bioenergie verlagert.
Die Task Force versteht ihre Arbeit als dauerhafte Begleitung der Energiewende. Insbesondere sollen darüber Impulse aus der Praxis in Planungs- und Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.



Artikel von
Harald Wedemeyer
Rechtsreferent und Referent für Erneuerbare Energien
- Klima, Tierwohl und Marktpolitik – Themenvielfalt im Milchausschuss
- Tierhaltungskennzeichnung und Tierwohl bleiben Stückwerk
- Vieh und Fleisch: Aussichten der Tierhalter bleiben vorerst unsicher
- Veterinärwesen: Aufarbeitung der ASP-Krise im Emsland läuft
- Pflanzenbau: Zwischen überzogenen EU-Vorgaben, unsicheren Märkten und Trockenperioden
- Ökolandbau: Hohe Ziele trotz Absatzschwierigkeiten
- Erneuerbare Energien: Verwertung von Gärresten auf landwirtschaftlichen Flächen möglich