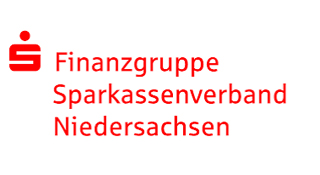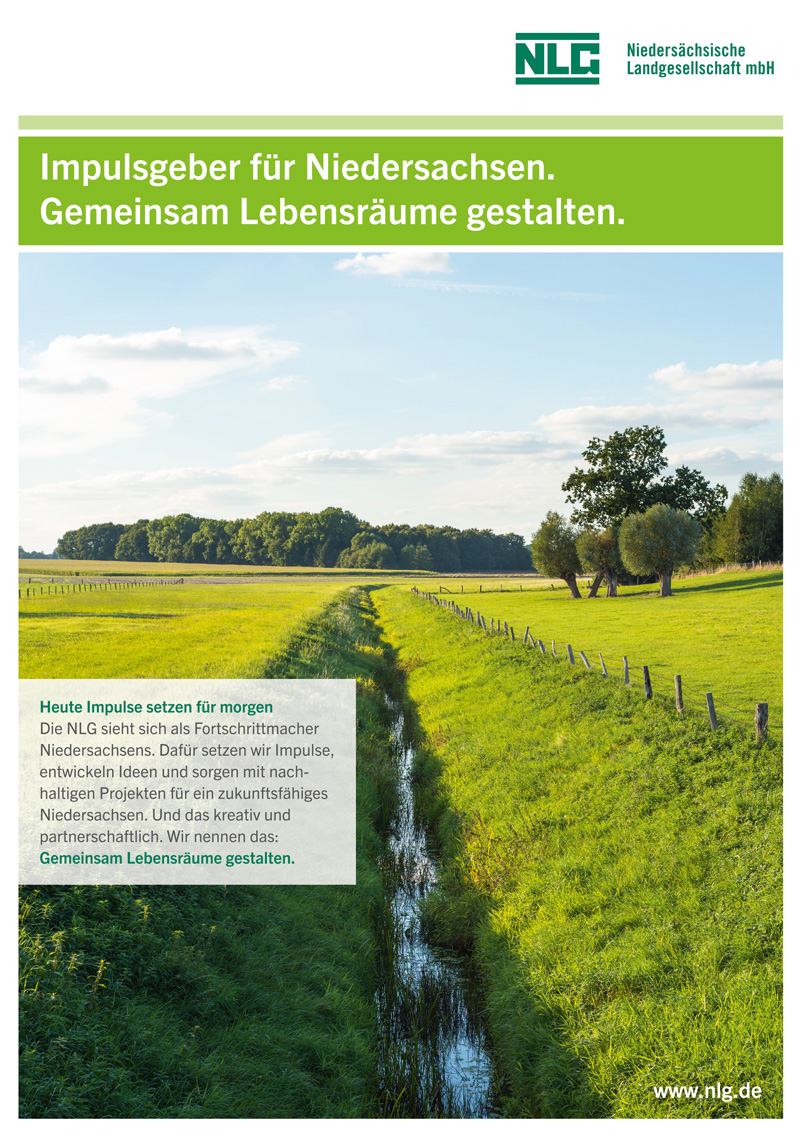Sozial- und Steuerpolitik
Sozialpolitik: Diskussionen um Sozialversicherungspflicht von Saisonarbeitskräften
Nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes arbeiten auf deutschen Bauernhöfen jedes Jahr ungefähr 300.000 Saisonarbeitskräfte vor allem aus Osteuropa zum Beispiel als Erntehelfer bei der Spargel- und Beerenernte. Die Festsetzung ihrer Sozialversicherungspflicht hat im vergangenen Jahr einige sozialgerichtliche Entscheidungen nach sich gezogen.
Ulrich Löhr
„Wir fordern den Gesetzgeber auf, die Berufsmäßigkeit der Saisonarbeitskräfte juristisch genau zu definieren, damit die Betriebe in Niedersachsen Sicherheit haben, wenn sie Sonderkulturen anbauen und Saisonarbeitskräfte beschäftigen. Dieser wertvolle Teil der Wertschöpfung im landwirtschaftlichen Bereich muss dauerhaft erhalten bleiben.“
Entscheidend ist, ob die Saisonarbeitskräfte in ihrem Herkunftsland als Arbeitnehmer beschäftigt sind und ob dort eine Versicherungspflicht besteht, die durch die A 1 Bescheinigung nachgewiesen werden kann. Dann ist das deutsche Sozialversicherungsrecht nicht anwendbar.
Sind Saisonarbeitskräfte allerdings nicht in ihrem Herkunftsland als Arbeitnehmer beschäftigt, besteht Versicherungspflicht, wenn die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 520 Euro im Monat übersteigt. Es sei denn, das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung liegt im Monat regelmäßig unter 520 Euro oder die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres ist auf längstens drei Monate beziehungsweise 70 Arbeitstage begrenzt.
Die Bewertungskriterien der DRV bei Betriebsprüfungen
Seit 1998 stellt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) einen bundeseinheitlichen Fragebogen zur Verfügung, durch den sichergestellt werden soll, dass die für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung ausländischer Saisonarbeiter notwendigen Ermittlungen bereits zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses erfolgen und zu einem späteren Zeitpunkt keine neuen Ermittlungen anzustellen sind.
Die Fragebögen fragen neben den Stammdaten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine abhängig beschäftigte Tätigkeit, Selbständigkeit, Arbeitslosigkeit, Schulbesuch/Studium oder Rentenbezug im Heimatland oder eine Tätigkeit als Hausfrau/Hausmann ab. Ursprünglich verlangte die DRV die Vorlage von Nachweisen hinsichtlich des Bestreitens des Lebensunterhaltes, wenn die Fragen hinsichtlich der abhängigen Beschäftigung bis Rentenbezug Heimatland (Frage 1 – 5) mit „Nein“ beantwortet wurden. Die Frage nach Hausfrau/ Hausmann wurde erst im Anschluss gestellt. Die überarbeiteten Fragebögen der DRV verlangen nun die Vorlage von Nachweisen, wenn sämtliche Fragen mit „Nein“ beantwortet wurden.
Bei Aufnahme einer kurzfristigen Beschäftigung (drei Monate oder 70 Arbeitstage) muss die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber im Wege einer vorausschauenden Betrachtungsweise eine Beurteilung über den sozialversicherungsrechtlichen Status des Arbeitnehmers treffen. Hierzu muss er alle für die Beurteilung des Beschäftigungsverhältnisses notwendigen Informationen vom Arbeitnehmer erfragen und aufzeichnen.
Haben die Saisonarbeitskräfte angegeben, in ihrem Heimatland als Hausfrau oder Hausmann beschäftigt zu sein, fordert die DRV die Vorlage weiterer Nachweise darüber, wovon der Arbeitnehmer im Heimatland seinen Lebensunterhalt bestreitet. Das Ankreuzen des Feldes „Hausfrau/Hausmann“ durch den Arbeitnehmer ist vom Arbeitgeber nach Ansicht der DRV kritisch zu hinterfragen und muss zu weiteren Ermittlungen führen, um den Sachverhalt zweifelsfrei aufzuklären und zu belegen.
Die DRV fordert, im Falle des Ankreuzens des Feldes „Hausfrau/ Hausmann“ durch den Arbeitgeber unter anderem vorzulegen:
- Heiratsurkunden
- Einkommenssteuernachweise Ehegatte
- Arbeitsverträge / Entgeltbescheinigungen der Familienangehörigen mit identischer
- Meldeanschrift
Macht der Arbeitgeber trotz nicht vorhandener oder unvollständiger Unterlagen geltend, dass Versicherungspflicht nicht bestanden habe, kommt es nach Ansicht des Rentenversicherungsträgers zu einer Umkehr der Beweislast. Liefert der Arbeitgeber keine Beweise, wovon die Arbeitnehmer im Heimatland ihren Lebensunterhalt bestreiten, werden die Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig eingestuft.
Die Reaktionen der Sozialgerichte Lüneburg, Freiburg und des Landessozialgerichtes Baden-Württemberg
Die Sozialgerichte Lüneburg, Freiburg und des Landessozialgerichtes Baden-Württemberg teilen diese Betrachtungsweise nicht. Sie sind der Ansicht: Eine Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei, wenn sie nur gelegentlich, das heißt nicht regelmäßig ausgeübt wird und keine berufsmäßige Tätigkeit vorliegt.
Eine berufsmäßige Tätigkeit liegt jedoch vor, wenn der Betreffende durch die Tätigkeit seinen Lebensunterhalt überwiegend oder doch in einem solchen Umfang erwirbt, dass seine wirtschaftliche Stellung zu einem erheblichen Teil auf der Beschäftigung beruht und diese damit nicht nur von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Unerheblich ist das Lohnniveau im Heimatland.
Es sind die gesamten Lebensverhältnisse des Beschäftigten zu berücksichtigen, die nicht nur allein durch die Verhältnisse während der Dauer dieser Beschäftigung geprägt werden. Das Maß der zeitlichen Inanspruchnahme der Beschäftigung ist ohne Bedeutung. Berufsmäßigkeit wird nicht bei Schülern, Studenten während der Semesterferien, Rentnern, Hausfrauen und Hausmännern angenommen.
Es existiert keine gesetzliche Definition des Begriffes „Hausfrau/Hausmann“. Da der Rentenversicherungsträger jedoch für diese Gruppe besondere Kriterien geschaffen hat, ist die Bedeutung des Begriffs durch Auslegung zu ermitteln.
Hausfrauen und Hausmänner sind Personen, die vorübergehend einer Beschäftigung nachgehen und im Übrigen von anderen unterhalten werden und dadurch nicht auf die Ausübung einer Beschäftigung zum Erhalt ihres Lebensunterhaltes angewiesen sind. Hierdurch wird die Berufsmäßigkeit ausgeschlossen. Allein der Umstand, dass jemand ledig ist, bedeutet allerdings nicht, dass die Person keine Hausfrau/Hausmann sein kann. Es kann der Haushalt von Verwandten geführt werden.
Das Gesetz bietet keine ausreichende Grundlage, den Arbeitgeber zu komplexen rechtlichen Wertungen und weiteren umfangreichen Ermittlungen zu verpflichten, die der Rentenversicherungsträger verlangt. Ohne gesetzliche Grundlage ist es dem Arbeitgeber nicht erlaubt, die privaten Lebensumstände seiner Arbeitnehmer auszuforschen. Es besteht keine Verpflichtung der Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber ihre privaten Verhältnisse zu offenbaren.
Der Arbeitgeber ist keine Behörde. Es gilt daher nicht der Amtsermittlungsgrundsatz und der Arbeitgeber ist in seinen Ermittlungsmöglichkeiten eingeschränkt.
Nach Ansicht dieser Gerichte stellt die Auffassung der DRV eine unzutreffende Interpretation des Amtsermittlungsgrundsatzes dar. Der Arbeitgeber kann nicht zu eigenen weiteren Ermittlungen verpflichtet werden.
Wenn der Rentenversicherungsträger hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes der Angaben der Arbeitnehmer Zweifel hat, liegt es ausschließlich in seinem Kompetenzbereich, ergänzende Ermittlungen vorzunehmen.
Die Ansicht der Sozialgerichte Lüneburg und Landshut zur Berufsmäßigkeit
Das Bundessozialgericht (BSG) betrachtet ein Entgelt aus einer gelegentlichen Tätigkeit dann als geeignet, wesentlich zum Lebensunterhalt beizutragen, wenn es im Verhältnis zu den übrigen Einnahmen aus Haupttätigkeit etwas mehr als zehn Prozent beträgt. Die aus der zeitgeringfügigen Tätigkeit erzielte Vergütung hat eine mehr als untergeordnete wirtschaftliche Bedeutung, wenn die beschäftigte Person auf die Vergütung angewiesen ist, um zumindest zeitweise ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Wenn Saisonarbeitskräfte aus Niedriglohnländern den Zeitraum einer zeitgeringfügigen Beschäftigung in großem Umfang ausschöpfen, wird die wirtschaftliche Relevanz für ihren Lebensunterhalt kaum verneint werden können, sofern nicht konkrete weitere Einnahmen nachgewiesen werden. Berufsmäßigkeit ist bei einem großen Entgeltgefälle zwischen Deutschland und dem Herkunftsland in der Regel gegeben. Hier widersprechen die Entscheidungen den vorher zitierten Entscheidungen
Rumänien hat beispielsweise einen um 30 Prozent niedrigeren Mindestlohn als Deutschland, in Deutschland wird in drei Monaten mehr verdient als in der restlichen Jahreszeit in Rumänien. Können keine weiteren Einnahmen nachgewiesen werden, werden die Einnahmen aus der Saisonarbeit als wirtschaftlich relevant für den Lebensunterhalt angesehen, mit der Folge, dass Beitragspflicht angenommen wird.
Das Sozialgericht Lüneburg hat als Einkommensobergrenze für Alleinstehende einen Betrag in Höhe von 900 Euro ermittelt. Dieses entspricht der doppelten ehemaligen Geringfügigkeitsgrenze und ist daher als wesentlich für das Bestreiten des Lebensunterhaltes anzusehen. Außerdem entspricht es in etwa der Höhe des Regelsatzes bei Arbeitslosengeld II zuzüglich der Kosten der Unterkunft. Werden Einkünfte aus der Saisonarbeit erzielt, die über dieser Grenze liegen, liegt Berufsmäßigkeit vor, da die Einkünfte weitestgehend geeignet sind, den Lebensunterhalt der Saisonarbeitskraft zu decken.
Bei verheirateten Hausfrauen und Hausmännern liegt die Einkommensobergrenze bei 1.800 Euro. Die Wohnkosten in Deutschland sind davon in Abzug zu bringen. Bei Zugrundelegung dieser Ansicht scheint es im Moment auf eine Einzelfallprüfung hinauszulaufen.
Fazit
Das Bundessozialgericht hat bisher seine Auslegung des Begriffs der Berufsmäßigkeit nicht konkretisiert. Es wäre Sache des Gesetzgebers, die Vorschrift des § 8 I Zif. 2 SGB IV entsprechend zu konkretisieren.


Artikel von
Sandra Glitza
Referentin für Sozial- und Realverbandsrecht
Nebenerwerb: Viel mehr als nur „Feierabendbauer“
Die klassische Vorstellung des Nebenerwerbslandwirts ist der eines Betriebsinhabers, der anderswo, selbstständig oder angestellt, sein Geld verdient und abends nach Feierabend noch mit dem Schlepper auf dem Feld unterwegs ist oder sich im Stall um die Tiere kümmert. Dabei ist die Farbpalette des Nebenerwerbs viel bunter.
Christian Mühlhausen
„Wir möchten uns als Nebenerwerbsausschuss breiter aufstellen und werden daher zukünftig das Thema Einkommenskombination noch stärker in den Fokus unserer Arbeit nehmen. Auch weil dieses Thema politisch an Bedeutung gewinnt, wie das von Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte für 2024 angekündigte Diversifizierungsprogramm für schweinehaltende Betriebe zeigt.“
Immer häufiger stellen sich Nebenerwerbsbetriebe so dar, dass Standbeine, die nicht primär zur landwirtschaftlichen Urproduktion gehören, stärker zum gesamtbetrieblichen Umsatz beitragen, bis sie schließlich mehr erwirtschaften als die landwirtschaftliche Urproduktion selbst. Denn mit dem richtigen Konzept lässt sich heute auch mit Direktvermarktung, Tourismus, Bildungs- und Freizeitangeboten, landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nicht zuletzt erneuerbaren Energien gutes Geld verdienen.
Diversifizierung und Nebenerwerb im Wechselspiel
Oft erstmal versuchsweise und im Kleinen begonnen, werden solche „Nebenprojekte“ oft größer und gewinnen an wirtschaftlicher Bedeutung für das Betriebsergebnis. Somit wächst unbemerkt so mancher landwirtschaftliche Haupterwerbsbetrieb in den Nebenerwerb, jedenfalls wenn man die Definition heranzieht, dass ein Nebenerwerbsbetrieb dann vorliegt, wenn weniger als die Hälfte des Einkommens aus der Landwirtschaft selbst erwirtschaftet wird. Gerade in Zeiten von volatilen Agrarpreisen, unsicheren Marktbedingungen und durch die Klimaerwärmung immer unwägbarere Witterung erweist sich die Diversifikation des Einkommens, wozu natürlich auch das eingangs beschriebene klassische Bild des Nebenerwerbs gehört, als äußerst vorteilhaft.
Daher nimmt auch das Thema Diversifizierung beziehungsweise Einkommenskombinationen neben den „klassischen“ Nebenerwerbsthemen aus Steuer- und Sozialrecht im Nebenerwerbsausschuss des Landvolks Niedersachsen und des Deutschen Bauernverbands einen immer größeren Stellenwert ein. Neben dem Austausch über die verschiedenen Möglichkeiten außerlandwirtschaftlicher Standbeine – teilweise noch an der Urproduktion angedockt, aber gegebenenfalls auch völlig losgelöst von dieser – diskutieren die Ausschüsse über Möglichkeiten, diese „alternativen“ Einkommensmöglichkeiten durch bessere rechtliche Rahmenbedingungen und passgenaue Förderangebote zu stärken und tauschen sich darüber mit den wesentlichen Akteuren aus Politik und Wissenschaft aus.



Artikel von
Hendrik Gelsmann-Kaspers
Referent für Strukturpolitik
Steuerpolitik: Verbandliche Steuerberatung fördern statt bremsen
Vor etwa zehn Jahren waren sich die Zukunftsforscher sicher, dass die Digitalisierung Buchstellen und Steuerberater in kurzer Zeit überflüssig machen würden. Die Digitalisierung verändert die Arbeit tatsächlich grundlegend – von „überflüssig“ spricht aber niemand mehr. Buchstellen sind überlastet, erste Landwirte finden keinen Steuerberater mehr. Trotzdem wird die verbandliche Steuerberatung eher ausgebremst als gefördert.

Cord Kiene
„Der Verband arbeitet intensiv an der Entfristung der bewährten Tarifglättung für landwirtschaftliche Einkünfte. Die Regelung ist zum Ende des Jahres 2022 ausgelaufen. Sie ist aber erforderlicher denn je. Denn alle Produktionsbereiche, sei es Veredlung, Milchvieh oder Ackerbau sehen sich mit erheblichen Einkommensschwankungen aufgrund volatiler Märkte und Wetterextremen konfrontiert.“
Die Buchstellen und Steuerberatungsgesellschaften der Landvolkkreisverbände leisten seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Beratung der Landwirte. In allen Regionen Niedersachsens sind sie in Fragen von Steuern und Rechnungswesen bedeutender Ansprechpartner für Bauern, Banken und Finanzämter, oftmals der weitaus Bedeutendste. Es wird ein wichtiger Beitrag geleistet für die Ausbildung des Nachwuchses und den Aufbau von fachlicher Kompetenz durch Fortbildung bis hin zu Steuerberatern.
Verbandsbeitrag zur Steuerberatung fördern
Aktuell geht die Belastung der verbandlichen Buchstellen und Steuerberatungsgesellschaften – wie in der gesamten Branche – weit über das Leistbare hinaus. Das liegt in erster Linie am Fachkräftemangel, der trotz nachhaltiger Ausbildung immer drängender wird. Aber auch das Arbeitspensum wird immer größer und anspruchsvoller. Das hat vielfältige Gründe, genannt sei nur die immer noch steigende Komplexität des Steuerrechts und steigende Anforderungen durch wachsende und komplexere landwirtschaftliche Betriebe. Ausgeufert sind die Arbeitsrückstände durch zwei zusätzliche Aufgabenbereiche: Das Antragsverfahren um die Corona-Überbrückungshilfen sowie die Abgabe der zahllosen Erklärungen aufgrund der Grundsteuerreform.
Die Tätigkeit der Buchstellen und Steuerberatungsgesellschaften der Landvolkverbände leisten zuverlässige Beratung auf hohem Niveau, vor allem sind sie aber unersetzbar – die Kapazitäten, diese Beratung zu übernehmen, gibt es nicht. Geradezu grotesk erscheint vor diesem Hintergrund ein Gesetzentwurf, der allen landwirtschaftlichen Buchstellen in den Kreisverbänden den rechtlichen Boden nehmen sollte. Tausende von Höfen würden dadurch ihre bisherige Beratung verlieren. Erste Korrekturen am Gesetzentwurf konnte der Verband erreichen, erhebliche Einschränkungen sieht er bei Redaktionsschluss des Jahresberichts aber immer noch vor. Es ist dringend ein Kurswechsel von Gesetzgeber und Verwaltung erforderlich, weg vom Ausbremsen und hin zu Förderung der Tätigkeit und der Weiterentwicklung der Strukturen verbandlicher Beratung.
Energiewende darf nicht zur Steuerfalle werden
Immer noch ungelöst sind die erbschaftssteuerlichen Probleme der Freiflächenphotovoltaikanlagen. Der Deutsche Bauernband und seine Landesverbände haben die Politik wiederholt auf das drängende Problem hingewiesen, passiert ist jedoch noch nichts.
Werden landwirtschaftliche Flächen zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage an Betreibergesellschaften überlassen, wechseln sie nach Auffassung der Finanzverwaltung in das sogenannte Grundvermögen. Das kann kurz nach einer Betriebsübergabe an die nächste Generation zu empfindlichen Erbschaftsteuernachzahlungen führen. Vor allem kann die Übertragung einer solchen Fläche nach Errichtung der Freiflächenphotovoltaikanlage zu derart hohen Erbschaftsteuerbelastungen führen, dass dem Landwirt von der Überlassung abgeraten werden muss.
Die steuerlichen Folgen könnten vermindert werden, wenn sich der Flächeneigentümer in bestimmter Weise an der Anlage beteiligt – das ist jedoch oftmals nicht umsetzbar. Dringend erforderlich ist eine Regelung, die den Verbleib der mit Freiflächenphotovoltaikanlagen bebauten Flächen im landwirtschaftlichen Vermögen ermöglicht. Das müsste durch eine gesetzliche Klarstellung, mindestens aber durch eine Korrektur der Verwaltungsauffassung erfolgen.
Nachhaltige Besteuerung sicherstellen
Der Verband arbeitet nach wie vor intensiv an der Entfristung der bewährten Tarifglättung für landwirtschaftliche Einkünfte. Die Regelung ist zum Ende des Jahres 2022 ausgelaufen. Sie ist aber erforderlicher denn je. Alle Produktionsbereiche, sei es Veredlung, Milchvieh oder Ackerbau sehen sich mit erheblichen Einkommensschwankungen aufgrund volatiler Märkte und Wetterextremen konfrontiert. Die Tarifglättung erweist sich dabei als wirksames Instrument, um eine Besteuerung der Landwirtschaft entsprechend ihrer nachhaltigen Leistungsfähigkeit herzustellen. Die Entlastungswirkung ist in Fällen mit hohen Schwankungen erheblich und die Praxis hat gelernt, mit der Regelung umzugehen.
Die Tarifglättung mildert die Progressionswirkung von Schwankungen der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Dabei wird die Einkommenssteuer innerhalb der jeweiligen Glättungszeiträume von drei Jahren auf den Betrag gemildert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der Einkünfte auf diese Jahre ergibt. Da die Bedeutung der Regelung noch gestiegen ist, fordert der Deutsche Bauernverband gemeinsam mit den Landesverbänden die unbefristete Fortgeltung der Regelung.
Grenzen setzen für Grundsteuerbelastung
Ab dem 1. Januar 2025 darf die Grundsteuer nur noch nach den reformierten Werten erhoben werden. Im Focus der öffentlichen Wahrnehmung steht dabei vor allem der Kraftakt von Grundstückseigentümern und Beratern sowie dann auch von Finanzämtern und Kommunen, diese Reform mit Erklärungen und Bescheiden umzusetzen. Ob das bis zum Jahresende 2024 gelingt, wird sich zeigen.
Bedeutung gewinnt aber spätestens im Jahr 2024 die Frage, welche Steuerbelastung daraus resultiert. Versprochen wurde eine aufkommensneutrale Reform. So enthält das niedersächsische Grundsteuergesetz eine Regelung, nach der jede Kommune berechnen und veröffentlichen muss, welche Hebesätze bei der Grundsteuer A und B erforderlich wären, um aus den neuen Grundstückwerten ein unverändertes Grundsteueraufkommen zu erzielen. Das bedeutet, dass die Gemeinde ihr Grundsteueraufkommen durchaus erhöhen darf – sie muss es nur transparent machen.
Landwirte müssen bei der Festlegung der Hebesätze ihrer Gemeinde besonders aufpassen. Das bisherige Aufkommen der Grundsteuer A resultiert aus den Einheitswerten der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Darin ist neben dem Wirtschaftsteil auch die Bewertung der Wohnungen enthalten – sie machen etwa ein Drittel der Einheitswerte aus. Die neuen Grundsteuerwerte für Höfe und damit die Grundsteuer A berücksichtigen jedoch ab dem Jahr 2025 nur noch die Wirtschaftsteile. Für alle Wohnungen zahlen die Landwirte dann zusätzlich Grundsteuer B. Um aufkommensneutral zu sein, müssen also die Einnahmen aus der Grundsteuer A etwa um ein Drittel sinken. Das ist jeweils eine politische Entscheidung auf Kommunalebene – muss also im Gemeinderat durchgesetzt werden.
Überdies kann „Aufkommensneutral“ immer nur die Grundsteuereinnahmen der gesamten Kommune meinen. Die starke Vereinfachung der Bewertung insbesondere für die Grundsteuer B wird innerhalb der Gemeinde zu erheblichen Belastungsverschiebungen führen. Auf alte Wohnhäuser im Außenbereich wird eher eine erhöhte Grundsteuerbelastung zukommen.



Artikel von
Cord Kiene
Steuerreferent